PALMBAUM e.V. - Zeitschrift
»Palmbaum ~ Literarisches Journal aus Thüringen«
Leseproben:
Weimarzentrismus – so lautet ein beliebter Vorwurf gegen alles,
was aus Weimar oder dessen Umfeld kommt. Wie die Literarische Gesellschaft,
die an der Ilm ihren Sitz hat, oder der Palmbaum, der im Nachbartal
wurzelt. Natürlich nervt es auf die Dauer, wenn ein Ort seit 200
Jahren behauptet, die Literaturhauptstadt der Deutschen zu sein und
dabei permanent mit alten Karten spielt.
Als sei Alter an sich schon ein Wert. Oder geht es um etwas anderes?
Was zieht die Leute wieder und wieder in diese Stadt? Die Sehnsucht
nach einer verlorenen Harmonie? Die es niemals gab in diesem Musendorf,
wo man um 1800 noch Kühe durch die Gassen trieb, wo ländliche
Armut mit kulturell ambitionierter Hofhaltung Hand in Hand ging. Weimar,
das heißt „ideell“, immer wieder über die Grenzen
des Bestehenden hinaus zu drängen. Und Weimar heißt auch,
reell, immer wieder mit hochfliegenden Plänen Schiffbruch zu landen,
eingeholt zu werden vom „durchaus Scheißigen“ der
irdischen Verhältnisse, wie es Goethe in seinen jüngeren Jahren
auf den Punkt zu bringen pflegte.
Die folgenden Beiträge bewegen sich zwischen den Polen des ideellen
und des realen Weimar. Sie laden zu erneuter Sicht auf scheinbar Altbekanntes
ein und wollen Neugier auf das kommende Weimar wecken, das sich im Hier
und Heute wandeln muss. Dass dieser Wandel sich nur im politischen Raum
vollziehen kann, haben die vergangenen Monate seit dem letzten Heft
deutlich gemacht. Die Diskussionen um die Finanzierung des Kulturstandortes
Thüringen, und darüber hinaus die Verfassungs-Debatte um Kultur
als „Pflichtaufgabe“ des Staates generell, halten unvermindert
an. Der Palmbaum hat in Heft 2/06 mit einem Essay von Peter D. Krause
zum inhaltlichen Streit aufgerufen: Welche Kultur wollen wir um welchen
Preis? Im vorliegenden Heft stehen erste Erwiderungen. Mögen sie
den nötigen Widerspruch provozieren.
Das nächste Mal wollen wir das Netzwerk literarischer Ort nachzeichnen,
das die Thüringer Landschaft wie kaum eine andere mit ungeheurer
Dichte über Jahrhunderte hinweg durchzieht. Weimar wird dann wieder
nur ein Punkt unter vielen sein...
...
Jens-Fietje Dwars
Aus: Palmbaum ~ Literarisches Journal aus Thüringen, Heft 1/2007
Matthias
Biskupek
Der Theaterdonnerer
Erwiderung auf Peter D. Krauses „Rhetorische Kultur – Bekenntnis
zum Anachronismus“ (PALMBAUM 2/2006)
I
Es ist wunderbar, wenn ein Landtagsabgeordneter sich zu Fragen der Kultur und deren Förderung essayistisch äußert. Es ist ver-wunderlich, wenn dies so altbacken geschieht. Ärgerlich wird es, wenn eine für den „Bekennenden Anachronisten“ von vornher-ein feststehende These bloß illustriert wird. Krauses Rede näm-lich heißt: Die 68-er haben die Kultur zerstört und jetzt müs-sen wir (Konservativen) just dies bezahlen.
Hochkultur
Krause etikettiert heutige Theaterarbeit mit „Hochkultur“.
Wenn er nichts vom Theater weiß, so weiß er offensichtlich
auch we-nig vom Leben. Hat er bei Jünger und Nietzsche nichts davon
ge-funden? Oder hat er nur flach gelesen?
Erinnern wir uns: Vor zwei-, dreihundert Jahren entstanden in vielen
Residenzen, besonders im kleinteiligen Thüringen, Stadt-theater.
Repräsentanten des Kunstwillens von Fürsten, aber auch einer
selbstbewußten Bürgerschaft. Die spielten ihre Klassiker,
ihre Naturalisten und ihre Zeitgenossen: nicht immer auf höch-stem
Niveau, aber immer mit Einsatz. Der legendäre Striese sprach mit
viel Gefühl und sächselndem Tonfall.
In den jüngsten Jahrzehnten aber wandelten sich diese Stadt-theater.
Von Repräsentanten-Tempeln einer wie auch immer gear-teten Hoch-Kultur
wurden sie zu soziokulturellen Zentren. Sie organisierten und bündelten
das geistige Leben für ihre Leute: für Schulen und Unis, Betriebe
und Vereine. Spiele für und von Kindern, Seniorennachmittage, Jugendclubs
und Diskussionsforen neuer Ideen. Die Stadttheater wurden Brennpunkte
geistiger Strömungen. Auch die Kirchen profitierten mit ihren Messen
und Adventsmusiken von den Berufsorchestern der Theater – und
nicht zuletzt waren die alten Musentempel zu beachtlichen Arbeitge-bern
der neuen Regionen geworden.
Dann aber schlug in Thüringen der Sparbeschlusshammer auf die herausragenden
Köpfe dieser Theater nieder: Effektivität durch Kooperation.
Schöne, große Häuser sollten von ihren Machern be-freit
werden – und eine Theaterversorgung möglichst zentral ge-regelt
werden. Als gute Gabe von oben.
Doch siehe, den Menschen der Region, den Provinzialisten schie-nen ihre
Theater nicht nur lieb, sondern sogar teuer. Die an-scheinend so biedere
Provinz erwies sich als geistig und finan-ziell regsamer, als das führungsschwache
Zentrum. Beginnend mit den Trägern des Theaters Rudolstadt und
seiner Thüringer Sinfo-niker nahm man den Ministerpräsidenten
beim Wort. Der nämlich hatte in einer seiner vielen schwachen Stunden
verkündet: Wenn lokale Träger mehr Geld geben, schießen
auch wir zu.
Weimar, Gotha, Nordhausen, Eisenach, Suhl – die Städte und
ihre Vertreter regten sich und wollten es pflegen: ihr Kultur-Erbe,
das eben nicht nur als Erbe verstanden wird, sondern als quick-lebendiger
Kultur-Raum. Voller dort arbeitender Menschen, die Städten ihr
Gesicht geben, Jugendlichen eine Perspektive und die Mär von provinzieller,
beschränkter, nationaldumpfer Klein-städterei ad absurdum
führen.
Doch die Landesregierung gibt zwar gern Millionen Fördergelder
zum Erhalt von ein paar Dutzend Arbeitsplätzen in ein paar Be-trieben
der global players. Nichts aber gelten ihr Hunderte und Tausende von
engagierten Kulturbürgern, die ihre uralten Musen-tempel unbedingt
behalten wollen: als moderne, von den eigenen Bürgern betriebene
Herzkammern eines selbstbewußten, regionalen und weltoffenen Kulturlebens.
Und so wird zerstört, was krauses Bestimmerdenken stört. Denn
wer die Macht hat, rechnet sich die Welt schön.
Milchmädchenrechnungen
Immer wieder werden Theaterzuschüsse in Euro und Cent angege-ben.
Jede Karte werde mit 125 Euro subventioniert. Beim Reprä-sentationstempel
des Ministerpräsidenten, der Erfurter Oper, ist es übrigens
mehr. Jeder Bürger bekomme ohnehin – von guten Regierungsparteipatrioten?
– 29 Euro für Theater geschenkt.
Wo aber bleibt jene Rechnung? Für den Bau einer Ortsumgehungs-straße
wird jeder Dorfbewohner mit ein paar zehntausend Euro subventioniert.
Blödsinn? Richtig – wie Theaterzuschussrechnun-gen.
Krause und seine Parteifreunde - jene von der DDR-Vorgängerpartei
CDU – erzählen immer wieder von den „Geberlän-dern“,
die Thüringens Kultur subventionierten. Und vorm Grimm und Hohn
dieser „Geberländer“ muss der Ministerpräsident
Thü-ringens geschützt werden, wenn er demnächst vielleicht
doch im Bundeskabinett sitzen will.
Wie verteilen sich Geben und Nehmen wirklich? Eine hochmoderne Fabrik
in Thüringen nimmt hiesige Arbeitskräfte (sofern nicht gerade
den Geschäftsführer), hiesige Luft für ihre Rußpartikel,
hiesiges Wasser zum Erwärmen, hiesige Straßen für ihre
Trans-porte und verkauft ihre Produkte natürlich auch den Hiesigen,
deren Geld sie dafür nimmt – Gewinne und Steuern aber gibt
sie den Landesvätern Bayerns oder Hessens. Weil sie juristisch
dort im gemachten Nest sitzt. Und die „Geberländer“
wehklagen dann mit der Stimme des Peter D. Krause, dass sie ihr letztes
Hemd den Thüringern schenken und deshalb ihre Kunst nackich geht.
Umgekehrt: Wenn ein Thüringer Theater im fernen deutschen Süden
oder Westen spielt, so gilt das als Einnahme für das jeweilige
Theater. Ein paar tausend Euro. Die Eintrittskarten für die je-weilige
südwestdeutsche Stadthalle werden dort kostendeckend verkauft –
und alle sind’s zufrieden. In Wirklichkeit aber ha-ben in einem
solchen Fall die Thüringer Steuerzahler das süd-westdeutsche
Theaterereignis subventioniert. Denn die wirkli-chen – und nicht
geringen – Kosten fallen am Theaterstandort an.
Sprechblasen
„Die moralisierende Affekterregung ist ein zentrales Element
politischer Hermeneutik.“ „Die Hypermoralisierung (?) der
ver-öffentlichten Meinung ist das Ergebnis der Entrealisierung
des Politischen.“ „Institutionen, (die) lustvoll-suizidal
geschlif-fen werden oder worden sind, soll der Staat nun alle (finanzi-ell)
substituieren. Als letzte Institution soll er rasant wech-selnde neue
Systeme und viele Anachronismen stützen“.
Ob die Systeme wirklich schnittig wechseln, weiß ich nicht –
immerhin wusste Friedrich Nietzsche noch, dass mit „rasant“
keineswegs „rasend schnell“ gemeint ist. Ein Bildungszögling
der grauenhaften DDR muss das natürlich nicht mehr verstehen –
es genügt, wenn er Hans Magnus Enzensberger in falschem Zusam-menhang
zitiert. Enzensberger, der völlig richtig feststellt: „Wer
Theater spielen, Installationen hervorbringen oder Ge-dichtbände
schreiben will, sollte sich darüber im klaren sein, dass er sich
auf höchst riskante Tätigkeiten einlässt.“ Diese
höchst riskanten Tätigkeiten werden von Enzensberger aber
nicht nur als finanziell riskant gesehen – wer Kunst macht, setzt
sich mit seinem Leben ein. Er beschädigt sich, er zerfleischt sich,
er frisst in sich hinein, schenkt sich weg und gibt sich hin. Und deshalb
ist Enzensbergers Schlussfolgerung, Kunst vom Beamtenrecht zu trennen,
richtig. Doch nicht, wie Peter D. Krause glaubt, wegen „der rasanten
(!) gesellschaftlichen Ver-änderungen, wegen der fehlenden kulturellen
Dissidenz gegenüber der Dekadenz“, sondern weil es doch merkwürdig
ist, dass aller-orten Beamte oder ähnlich hochdotierte und finanziell
gut abge-sicherte Demokratievertreter über das Geld für die
Kunst bestimmen. Geld, das nicht ihres ist – auch wenn sie sich
für jede „Zuwendung“ gern medial feiern lassen.
Drum wäre es hilfreich, wenn diese Kunstregulatoren – ich
kann hier weder auf Jünger, Ernst oder Friedrich, noch auf Ortega
y Gasset verweisen, sondern bloß auf Friedrich Gerstäckers
„Die Regulatoren von Arkansas“ - ein paar Segnungen der
Kunst für sich entdeckten. Und sei es, dass sie Essays in klugem
und schönem – nicht rhetorischem - Deutsch schrieben.
Friedrich
Schorlemmer
Das Feld der Ehre und die Ährenfelder
Zur Erinnerung an die Schlacht von Jena und Auerstedt
I
Die Geschichte der Menschheit, bis an unsere Urgründe und Ursprünge
zurückverfolgt, beginnt in den Büchern des Alten Testaments
nicht nur mit einem Brudermord, sondern auch mit der Konkurrenz zwischen
zwei Lebensweisen: nämlich dem nomadischen Viehzüchter Abel
und dem sesshaften Landmann Kain, der seinen Blick verfinstert, seinen
Kopf senkt, also dem anderen nicht frei in die Augen sieht und über
den etwas Böses herrscht, bis er sich selbst vergisst.
Da sagt Kain zu seinem Bruder: „Komm, lass uns aufs Feld gehen.“
Damit beginnt der ganze Menschheitsschlamassel. Seither schreit das
Blut der toten (Menschen-)Brüder aus der Erde, dem Ackerboden,
dem Felde der Feldschlachten, der verordneten Schlächtereien.
Menschen werden aufs Feld geschickt, um die Ähren zu ernten oder
die Ähren zu lesen. Menschen werden aufs Feld geschickt zur Schlacht,
zum Schlachten, zum Abschlachtwettbewerb mit dem Kürzel „Krieg“.
Das Kampffeld soll das Bewährungsfeld werden. Am Schluss werden
Leichen abgelesen, statt die Ähren zu lesen. Danach werden Steine
aufgerichtet. Zur Erinnerung an „unsere Helden.“
Nach der Schlacht von Jena und Auerstedt wurde die gesamte eingebrachte
Ernte vernichtet. Und doch bleibt die große Menschheits-Vision:
die von der endgültigen Verwandlung von „Schwertern zu Pflugscharen“.
Das ist die große Konversion, vor der jede Generation wieder neu
steht: dass die Schwerter, die Blut bringen, zu Pflugscharen werden,
die Leben bringen. Brotkörner statt Schrotkörner. Und Winzermesser
für den Wein, statt Spieße in den Bauch.
Krieg – ein typisch männliches Bewährungsfeld? Endlich
heraus aus der Langeweile des Alltags. Etwas Großes geschieht.
Der Kriegsgott als Gott der Stärke, der Männlichkeit, Tapferkeit,
Unerschrockenheit. Lebenslang wird davon erzählt. Hier kommen männliche
„Tugenden“ zum Tragen – im ewigen Streit zwischen
dem Lebenskonzept „Sparta“ und dem von „Athen“.
Der „Herr der Heerscharen“ steht Pate, – oder Jupiter
und Mars. Da geht es um Gehorsam, (Todes-)Mut, Kameradschaft und Liebe
zum Vaterland, die man mit seinem eigenen Blut auf dem „Feld der
Ehre“ bezahlt.
Das Feld: Das Getreidefeld, das Landefeld, das Ruhefeld, das Kräftefeld,
das Erntefeld, das Schlachtfeld, das Flachfeld, das Brachfeld, Sehfeld,
das Eckfeld, das Blickfeld, das Kartoffelfeld, das Spielfeld, das Zielfeld,
das Stoppelfeld, das Riesenfeld, das Wechselfeld, das Mittelfeld, das
Kohlfeld, das Rollfeld, das Erdölfeld, das Rübenfeld, das
Grubenfeld, das Roggenfeld, das Birkenfeld, das Kohlenfeld, das Minenfeld,
das Wappenfeld, das Ährenfeld, das Gartenfeld, das Weizenfeld,
das Steinfeld, das Kornfeld, das Haferfeld, das Experimentierfeld, das
Exerzierfeld, das Ackerfeld, das Trümmerfeld, das Mauerfeld, das
Manöverfeld, das Angriffsfeld, das Spannungsfeld, das Versuchsfeld,
das Kolchosfeld, das Schussfeld, das Gefechtsfeld, das Gesichtsfeld,
das Arbeitsfeld, das Tätigkeitsfeld, das Saatfeld, das Magnetfeld,
das Kampffeld, das Schlachtfeld, das Sportfeld, das Blutfeld, das Kollektivfeld,
das Toleranzfeld, das Sturzfeld, das Feld ...
So viel mal Feld! Mythisch geworden das Amselfeld, das Lechfeld, das
Totenfeld vor Verdun, die Felder im Kursker Bogen, die Seelower Höhen.
Wie viel mal Feld! Wie viel mal Friedensfeld, wie viel mal Kriegsfeld,
wie viel mal Erkenntnisfeld, wie viel mal Sackgasse?
In der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts blieben sie „für
Gott, König und Verland“ auf dem Felde. Sie starben angeblich
„für uns“. Und als Helden, selbst in der Niederlage.
Ich habe in meiner Kinderzeit immer wieder den Satz gehört: Der
Vater, der Bruder oder der Ehemann seien „im Felde geblieben“
oder sie seien „gefallen“. Das ist verharmlosende, verschleiernde
Sprache, die sich nicht zutraut, zu sagen, was ist. Sie wurden erschossen,
erwürgt, verkamen in dem Grauen mörderischen Schlachtens.
Begräbnisrituale für getötete Soldaten setzen immer wieder
das Schwülstige über das Blutige.
Man verfolge nur das Gedenken an die getöteten Soldaten im Irak
oder in Afghanistan und erinnere sich auch an das, was die Russen nach
ihrem Einmarsch 1980 dort vorexerziert haben. Immer wieder kommt die
religiöse Legitimation oder die geistige Munitionierung der Kriege
auf. Denen, die einen geliebten Menschen verloren haben, muss wenigstens
ein Sinn suggeriert werden – am besten einer, der mit der Ewigkeit
zu tun hat.
So werden betende Amerikaner mit Abendmahlskelch gezeigt, die im März
2003 in die Schlacht gegen des Diktators Anhänger gehen –
ganz so, wie wohl die Iraker, die sich ihres Allahs, des Einzigen und
Allmächtigen, erinnerten und vergewisserten, ehe sie die ungläubigen
Eindringlinge zurückzuschlagen versuchten.
Wer über Krieg und Frieden nachdenkt und offen spricht, kommt selber
ins Minenfeld. So äußerte sich die Irak-Kriegsbefürworterin
Angela Merkel und ungetrübte Freundin des amerikanischen Präsidenten
Bush, dass man aus dem Irak-Krieg die Lehre ziehen müsse, dass
es schlecht ist, wenn man nicht mit einer Stimme spricht. Ich frage,
mit welcher? Mit der Bushs? Sie sagte nichts über den Irak-Krieg
und seine unabsehbaren Folgen oder dass der Lügen-Krieg vielleicht
gar gezeigt hätte, dass Krieg keine Lösung ist und Prävention
wesentlich vorbeugende, zivile Maßnahmen – auch entschlossene
– meint und nicht, vorbeugend Krieg zu führen. Wer die militärisch-technischen
Probleme zu lösen sich anschickt, ohne die geistigen und psychologischen
und gar die sozialen mit anzupacken, sät nur neue Gewalt.
Die Bundeskanzlerin hat auch nicht gesagt, dass das Recht internationale
Macht braucht, statt dass weiterhin eine Macht mit dem „Recht
der Macht“ agiert. Zum 11. 9. 2006 kamen endlich andere Töne:
„Nicht allein auf Gewalt setzen und das Völkerrecht achten“,
sagte sie. Späte Einsicht, aber Einsicht – während Bush
weiterhin den militärischen „Sieg über den Terrorismus“
anstrebt und verspricht. Es sei noch angemerkt, dass Angela Merkel in
den Zeiten der gefährlichen Ost-West-Konfrontation zu den tapfer
Schweigenden gehörte – statt bei den Problemen Abrüstung
und Kriegsvermeidung, Abbau von Feindbildern und tödliche Ausschließlichkeitsideologien
den Konflikt mit dem sogenannten Friedensstaat zu riskieren. Wer ihr
heute deutlich widerspricht, kommt leicht in den Verdacht parteipolitischer
Stellungnahme. Es ist wie immer. Wer sich zeigt, kriegt eins auf die
Mütze. Man kann nur froh sein, dass die Differenz nicht in Kriegszeiten
benannt wird; da kennen kritisierte Krieger kein Pardon.
II
Ein Blick zurück: 1806 hat Preußen auf den Feldern vor Jena
und Auerstedt verloren, vernichtend – nach der für die Österreicher
verlorenen Schlacht bei Austerlitz. Dieser Niederlage verdanken wir
schließlich die Reform Preußens, aber auch die Geburt des
deutschen Nationalismus in den Befreiungskriegen, der schließlich
zu dem Krieg 1870/71 führte, wo die „Einheit in Blut und
Eisen“ geschmiedet wurde. Sodann die Revanche, die Niederlage
1918 mit Demütigungsvertrag. Eroberung von Paris im Juni 1940 mit
großem Pomp. Schließlich erneute Niederlage 1945.
Die Niederlage am 8. Mai 1945 war letztendlich für uns Deutsche
eine Befreiung – so viel Leid sie auch für Deutsche in der
Folge des anderen zugefügten Leides bedeutete. Und es gab Aussöhnung
mit Frankreich, Polen und der Sowjetunion in Folge von Entspannungspolitik.
Deutsche bewährten sich „auf dem Felde der Politik“,
weil sie eben einsahen, dass Krieg stets Scheitern von Politik bedeutet
und nicht Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln.
Wir Deutschen „verdanken“ der schließlich friedlich
herbeigeführten, aber durchaus auch mit Rüstungskonkurrenz
zustande gekommenen Niederlage eines Weltsystems, dass wir jetzt in
Frieden und Demokratie in einem vereinten Europa leben.
III
Die bellizistische Tradition in der Kirche – insbesondere in
der deutsch-protestantischen – ist tief verwurzelt. Da wird in
einem Gebetbuch von 1705 von Seiner Königlichen Majestät vorzubeten
verordnet: „Absonderlich wollest Du, o großer Gott, Deinem
Gesalbten, unserem lieben Landesvater bei seiner Regierung geben ein
weises Herz, königliche Gedanken, heilsame Ratschläge, gerechte
Werke, tapferen Mut, starken Arm, verständige Räte, sieghafte
Kriegsheere, getreue Diener und gehorsame Untertanen ... weil auch seiner
Majestät Truppen und Armeen noch immer zu Felde ziehen müssen,
so begleite Du sie, o Herr! mit der Wacht deiner heiligen Engel, berate
sie vor Verräterei, Neid, Missgunst und Uneinigkeit.“
Strikter Untertanengehorsam war es, der dazu führte, dass die Heere
auch „ordentlich“ ausrückten und möglichst sieghaft
zurückkehrten.
In einer Predigt 1913 blickte Pfarrer A. Eckert auf 1806 zurück:
„Es war Gottes Wille, dass unser Preußenvolk 1806 und 1807
gedemütigt wurde, und der Ruhm der preußischen Waffen bei
Jena und Auerstedt erblasste. Dieses Volk musste durch ein Läuterungsgericht
hindurchgehen, um zu neuen Höhen emporsteigen zu können. Und
derselbe Gott, der das Volk in die Tiefen der Schmach geführt hatte,
hob es mit starker Hand wieder in die Höhe. Als die Macht des Korsaren
auf den Eisfeldern Russlands zerbrach, wurden unserem Volke die Augen
aufgetan: ‚Das ist Gottes Finger!’, so ging es wie ein Schrei
durch das Preußenvolk.“
Der Krieg als große Reinigung, als ein göttliches Läuterungsgericht,
bis es dann doch wieder zu neuen Höhen kommt, eben durch militärische
Siege – 1813 und 1870/71.
Es war das Pathos der Befreiungskriege, das im Nazismus trefflich genutzt
werden konnte, insbesondere, wenn Deutschtümelei und Luthertum
vermischt wurden, wie dies in Ernst Moritz Arndts „Vaterlandslied“
von 1812 geschah:
Der Gott, der Eisen wachsen ließ,
der wollte keine Knechte.
Drum gab er Säbel, Schwert und Spieß
dem Mann in seine Rechte,
drum gab er ihm den kühnen Mut,
den Zorn der freien Rede,
dass er bestände bis aufs Blut,
bis in den Tod die Fehde.
...
Wir wollen heute Mann für Mann
mit Blut das Eisen röten,
mit Henkersblut, Franzosenblut –
O süßer Tag der Rache!
Das klinget allen Deutschen gut,
das ist die große Sache.
Auch solche Lieder wurden im protestantisch geprägten deutschen
Reich natürlich in den Kirchen mit vaterländischer Inbrunst
gesungen. Dieser Logik folgten die Kirchen- und Staatsführer in
England, in Frankreich, in Belgien, in Russland. Allerchristlichste
Sieges-Bitt-Lieder gegeneinander!
Dagegen steht die Hellsichtigkeit eines Erich Mühsam, der bereits
im Februar 1914 in seiner Zeitschrift KAIN über das große
Morden schrieb: „ Man schämt sich allmählich vor sich
selbst, immer und immer wieder den moralischen Gemeinplatz aussprechen
zu müssen, dass Krieg schlecht und hässlich, Friede gut, natürlich
und notwendig ist. Aber wir wollen noch tausendmal die Gründe der
anderen widerlegen, um vor der Nachwelt nicht in der lächerlichen
Haltung solcher dazustehen, die vor Dummheit und Herzenskälte resignieren
und kapitulieren. In diesem Zeitalter raffiniertester technischer Zivilisation
gibt es für den Erfindergeist immer noch keine höheren Aufgaben
als die Vervollkommnung der kriegerischen Mordinstrumente. Wessen Gewehre
und Kanonen am weitesten schießen, am schnellsten laden, am sichersten
treffen, der hat den Kranz. Das Scheußliche und Groteske gehen
Hand in Hand durch das zwanzigste Jahrhundert und rufen die Völker
auf zur Bewunderung der Weltvollkommenheit.“
Da schreibt einer am Anfang des 20. Jahrhunderts, was in schrecklicher
Weise Wirklichkeit werden sollte. Dabei hätte wohl jeder denkende
Mensch – mindestens seit dem Dreißigjährigen Krieg
– wissen und begreifen können, was Krieg ist und was Krieg
nicht nur aus der Welt macht, die er zerstört, sondern auch aus
den Menschen, die an der Zerstörung teilhaben und mit gutem Gewissen
oder gar „keckigem Mut“ andere töten, die eben nicht
mehr Menschen sind, sondern Feinde: Franzosen oder Russen.
Mich beschäftigt seit meinen Kindertagen ein Widerspruch, den ich
mir mit 14 Jahren – eine Browning mit 16 Schuss in der Hand –
bewusst machte. Im Krieg ist Töten erfordert, und wer die meisten
tötet, der ist der größte Held. In Friedenszeiten steht
auf Mord die Höchststrafe. Und Töten im Krieg darf man nicht
Mord nennen, denn er ist ja befohlen. Krieg ist also der zivilisatorische
Ausnahmezustand, in dem Töten gerechtfertigt wird.
Der Theologe Günther Dehn, der in der Revanchestimmung Deutschlands
1930 Pazifist zu sein wagte, wurde von einer aufgebrachten Studentenschaft
aus Halle an der Saale vertrieben. In diesem Zusammenhang schrieb Kurt
Tucholsky 1931 seinen kleinen Essay „Der bewachte Kriegsschauplatz“,
dessen eine Wortfigur bis heute die Diskussion aufwallen lässt:
„Soldaten sind Mörder.“
Der Streit um diesen Satz ist bis heute nicht zu Ende. Tucholsky beklagt
die Hetze gegen einen Professor Gumbel, der einmal „die Abdeckerei
des Krieges ‚das Feld der Unehre’ genannt hat“. Er
wies darauf hin, dass im Krieg zwei Wirklichkeiten nebeneinander bestehen,
das normale bürgerliche Leben und der Kriegsschauplatz: „Da
gab es vier Jahre lang ganze Quadratmeilen Landes, auf denen war der
Mord obligatorisch, während er eine halbe Stunde davon entfernt
ebenso streng verboten war. Sagte ich: Mord? Natürlich Mord. Soldaten
sind Mörder.“
IV
Nicht nur die Kirchen der Welt seien daran erinnert, dass Papst Benedikt
XV. bereits im Sommer 1915 den „Krieg als eine grauenhafte Schlächterei“
gegeißelt und davon gesprochen hatte, dass „Bruderblut das
Land tränkt und das Meer färbt“. In einem inständigen
Appell, in einem Aufschrei für den Frieden schrieb er: „Mögen
bald Dankgebete für die Versöhnung der kriegführenden
Staaten emporsteigen zum Höchsten, dem Schöpfer alles Guten;
mögen die Völker, vereint in brüderlicher Liebe, den
friedlichen Wettstreit der Wissenschaft, der Künste und der Wirtschaft
wiederaufnehmen, und mögen sie sich, nachdem die Herrschaft des
Rechts wiederhergestellt ist, entschließen, die Lösung ihrer
Meinungsverschiedenheiten künftig nicht mehr der Schärfe des
Schwertes anzuvertrauen, sondern den Argumenten der Billigkeit und der
Gerechtigkeit, in ruhiger Erörterung und Abwägung. Das würde
ihre schönste und glorreichste Eroberung sein.“
Dies sei dem friedenstauben George W. Bush – und allen Menschen!
– ins Stammbuch geschrieben: Das Feld ist das Feld für die
Ähren, die Brot bringen. Die Felder dürfen nicht zu „Feldern
der Ehre“ depraviert werden, die mit dem vergossenen Blut auch
neuen Hass bringen.
Wer 2006 vor den blühenden oder bereits abgeernteten Feldern von
Auerstedt steht, der möge sich von Herzen des Friedens freuen und
ein mitleidiges Lächeln für die meist dickbäuchigen Männer
übrig haben, die gern in die alten Uniformen schlüpfen, um
Krieg nachzustellen – vielleicht, weil sie in ihrer Kindheit nicht
genug „Räuber und Gendarm“ gespielt und später
ihren Kopf kaum angestrengt haben. Das Volk bleibt verführbar und
entflammbar, zumal in jedem nationalen Rausch. Und es ist lenkbar auf
die Wege des Friedens. Die Kämpfe werden auf den Fußballfeldern
geführt und fair entschieden. Keiner bleibt auf der Strecke und
jeder trauert oder freut sich mit seiner Nation – bis zum nächsten
Spiel.
Aber Krieg ist kein Spiel. Er ist bitterster, allerbitterster Ernst.
Krieg ist nicht zum Nachspielen geeignet. Keine Verniedlichung des Krieges,
nachdem wir mit guten Gründen seine Heroisierung hierorts hinter
uns haben!
Aus: Palmbaum ~ Literarisches Journal aus Thüringen, Heft 2/2006
Peter D. Krause
Rhetorische Kultur
Bekenntnis zum Anachronismus
Waldgänger ist also jener, der ein ursprüngliches
Verhältnis zur Freiheit besitzt, das sich, zeitlich gesehen, darin
äußert, daß er dem Automatismus sich zu widersetzen
und dessen ethische Konsequenz, den Fatalismus, nicht zu ziehen gedenkt.
Ernst Jünger (Der Waldgang)
In seiner Autobiographie Ich nicht erinnert sich Joachim Fest
an seinen frankophonen Großvater: In dessen Bibliothek „standen
in ehrfurchtsgebietenden Lederausgaben die meisten Klassiker des Nachbarlandes.
Ich habe ihn manchmal im Auf und Ab vor seinem Schreibtisch Racine deklamieren
gehört“.
Arnold Gehlen beschrieb vor Jahren schon die politische Kultur der Bundesrepublik
als Dekadenz: als Unwilligkeit eines Volkes, die sachlich akuten Aufgaben
zu sehen. Er forderte dazu auf, der „industriell-technisch-szientifischen“
Welt nicht auszuweichen und nach bewahrenden, aber realistischen Optionen
in einer Welt der illusionären Politik zu suchen. Er sah, daß
die Welt utopistisch und rhetorisch geworden war: Rhetorik schafft die
Institutionen, da die Evidenzen fehlen.
Rhetorik ist seit der Antike der Begriff für die Theorie und Praxis
der persuasiven Rede in öffentlichen und privaten Angelegenheiten.
In der ars rhetorica sind die Gegenstände dreigeteilt unter dem
Gesichtspunkt der Wirkung: in Leidenschaften, Charaktere, Fakten. Affekte
vor allem konstituieren das rhetorische Überredungsverfahren. Wirkung
zählt. Nicht Wahrheit. Permotio animi: Das Beeinflussen, Rühren,
Erweichen war für die Alten die höchste Aufgabe des Redners,
denn es vermöge am ehesten, die Entscheidungen zu lenken. Der Beweis
tut gut, mächtiger noch wirkt der Affekt.
Wir leben in einer rhetorischen Welt. Rhetorik hat es nicht mit Wahrheit
zu tun, sondern mit Erwartungen.
Die Thüringer Landesregierung beabsichtigt, ab 2009 die Förderung
„der Kultur“ einzuschränken. Eigentlich geht es um
die Finanzierung der Theater und Orchester. Gründe für die
Kürzungen wie Argumente dagegen liegen auf der Hand. Einerseits:
das Geld fehlt. Andererseits läßt sich mittels „Streichorchester“
kein Landeshaushalt retten, sind die Kulturausgaben im Gesamthaushalt
vergleichsweise gering, wurden in Thüringen seit 1990 bereits acht
Orchester „abgewickelt“ oder zusammengelegt.
(Lassen wir lediglich den demagogischen Bezug der Kultur-Apologie auf
den Einigungsvertrag, wonach die „kulturelle Substanz“ im
Beitrittsgebiet keinen Schaden nehmen dürfe, bei Seite, weil er
die Ausgangssituation ignorant verkennt. Die ephemere DDR ist als bankrottes
Staat von den Staatsinsassen eliminiert worden. Aus Verzweiflung im
unendlichen Grau. Diese Kultur hatte keine Substanz. Ruinen schaffen,
hieß die tatsächliche Losung. Im großen Plan stand
die weltanschauungsgemäße Vernichtung bürgerlicher Freiheitskultur,
nach außen hin Humanismus-Propaganda. „Erbepflege“
war ein potemkinsches Schlagwort, die Altstädte standen vor dem
endgültigen Verfall, Sprenggenehmigungen für ganze Quartiere
waren erteilt. Wir zahlen die hochverschuldete DDR immer noch ab.)
Die Vielfalt der Kulturlandschaft ist ein Charakteristikum Thüringens.
Der Landeshaushalt beträgt knapp zehn Mrd. Euro. Der Rahmen der
Landeszuschüsse für kommunale Theater und Orchester soll ab
2009 den Betrag von fünfzig Mio. Euro nicht überschreiten.
Die geplante Einsparung von zehn Mio. Euro entspräche 0,13 Prozent
des Gesamthaushaltes. 1995 gab der Freistaat 161 Mio. Euro für
Kultur einschließlich Denkmalpflege aus, jetzt sind es 124 Mio.
Euro jährlich. Die Befürchtung, eine weitere Kürzung
würde in der kulturellen Zukunft Thüringens schädlichste
Folgen zeitigen, ist nicht von der Hand zu weisen. Allerdings argumentieren
mit ähnlichem Verve die Sozial-, Schul-, Wirtschafts-, Umwelt-
Renten-, Innen-, Gesundheitspolitiker und überhaupt alle Fachlobbyisten.
Was heißt „kulturelle Zukunft“?
Was die Rhetorik betrifft, so lassen sich ihre traditionellen Grundauffassungen
auf eine Alternative zurückführen. Hans Blumenberg faßte
sie zusammen: „Rhetorik hat es zu tun mit den Folgen aus dem Besitz
von Wahrheit oder mit den Verlegenheiten, die sich aus der Unmöglichkeit
ergeben, Wahrheit zu erreichen.“ Verlegenheit, das klingt angemessen.
Welcher Souverän mag sich daran gewöhnen, nur das auszugeben,
was erwirtschaftet wird? Und die Lage ist prekärer: wir müssen
jetzt das finanzieren, was wir uns in den jüngsten Jahrzehnten
geleistet haben, ohne es bezahlt zu haben. Das betrifft den Westen,
das meint auch etwa die DDR-Renten. Deutschland lebt unverdrossen im
Illusionismus und zelebriert die Wohlstandsverblödung. Laut Umfragen
hat sich die Nation insgeheim auf Abstieg eingestellt. Die Stabilität
wird durch Erbschaften und den Glauben an social engineering gesichert.
Der Sozialstaat zeugt seine Wähler selbst. Die wirtschaftliche
Situation wird vertagt. Wolfsschanzenmentalität. Von den großen
Versprechungen der sozialdemokratischen Epoche, von Gleichstellung und
Anerkennung, Emanzipation und Fortschritt, ist die Teilhabe an Privilegien
und Subventionen geblieben. Reformen sind allgemein en vogue, „Sparen“
sollen immer die anderen. Nehmen wir Berlin. Der Regierende Bürgermeister
kann sich nunmehr auf gerade mal 18 Prozent der Wahlberechtigten stützen.
Der Berliner Sozialhaushalt entspricht längst der Summe der Etats
für Kultur, Wissenschaft und Bildung, das Verhältnis wird
sich weiter hin zum Sozialen verschieben. Selbst der virtuelle Spielraum
schwindet. Der Staat wird von der Gesellschaft und ihren Erwartungen
erwürgt. Er hat dazu aufgefordert. Der zum Anspruchsberechtigten
mutierte neue Obrigkeitsstaatsbürger geht vernünftigerweise
dahin, wo ihm am meisten geboten wird. Die Zahl der Transferempfänger
steigt weiter – und damit die Wählerklientel verteilender
Parteien. Nur noch knapp die Hälfte der Berliner bestreitet ihren
Lebensunterhalt durch eigene Einkünfte, von den sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten kaum noch zu reden. Sie werden immer weniger, müssen
mehr leisten, werden politisch marginalisiert. Ein Modell für Deutschland?
Paternalistische Sozialverwaltung. Der Mensch – ein Bürger
mit Rechten und Pflichten? Wie steht es um die Bereitschaft der Deutschen,
als Bürger entscheiden und für die Folgen dann auch einstehen
zu wollen? Kant nannte eine Herrschaft, die auf dem Prinzip des Wohlwollens
gegen die Untertanen beruhe, den größten denkbaren Despotismus.
Die moralisierende Affekterregung ist ein zentrales Element politischer
Hermeneutik. Mehr denn je. Wer seine Betroffenheit nicht bekunden kann,
hat keine Chance im politischen Agon. Themen müssen emotional besetzt
werden; die demonstrative Empörung ist ein Muß. Die Hypermoralisieurng
der veröffentlichten Meinung ist das Ergebnis der Entrealisierung
des Politischen. Erregung, intellektueller Krampf, Scheindebatten beherrschen
die verunsicherte Szene. Die symbolische Geste der öffentlichen
„Buße“ ist ubiquitär. Es wird ungern entschieden,
es wird diskutiert. Der politische Streit entfernt sich von den Problemen.
Bürger bleiben zu Hause. Wirklichkeit heißt Wahrnehmung von
Ausschnitten, wir wählen frisch nach Stimmung. Der Sinn für
das Ganze ist selten vermittelbar. Zuständigkeiten sind kaum mehr
erkennbar. Interessen werden nicht geordnet und abgewogen, sondern in
der Reihenfolge bedient, in der sie Resonanz versprechen: Gerede, Bilder,
Einschaltquoten. Der Hang geht hin zur bloßen Anzeige der Handlungsfähigkeit:
konzertierte Aktionen, runde Tische, große Koalitionen. Alternativlosigkeit,
quasi die pluralistische Variante des Einparteiensystem. Der Wohlstand
erlaubt kapriziöses Wahlverhalten oder politische Apathie. Politische
Einstellungen ergeben sich aus kurzfristigen individuellen Absichten,
immer seltener aus Überzeugungen oder tiefen Prägungen. Public
relation ist ein erstrangiger Kompetenzbereich der Politik.
Wir tun so, als sei die politische Prämisse, auf Kosten kommender
Generationen zu leben, der Normalfall und keine verantwortungslose Perversität.
Es gibt weit mehr als vier Mio. Arbeitslose in Deutschland, aber auch
1,2 Mio. freie Stellen. Es geht nicht um Billigjobs. Die Hochqualifizierten
ziehen über alle Berge. Unterfinanzierung der Forschung und Überregulierung
vertreiben die Leistungsträger, jene also, die das Land am meisten
braucht, die unsere Kultur prägen. Zuwanderer wollen wir uns nicht
aussuchen, viele fallen direkt ins soziale Netz. Deutsche Spitzenkräfte
wandern ab, ausländische meiden uns. Unsere politisch-kulturellen
Debatten sind jene einer überalterten, müden, abgesättigten
Nation.
Kein Land auf der Welt hat so viele Opernhäuser, Theater, Orchester
auf engstem Raum versammelt wie Deutschland. Und Thüringen steht
an der Spitze. Der Standard ist extraordinär. Acht Mrd. Euro werden
jährlich in Deutschland von der öffentlichen Hand für
Kultur ausgegeben, dazu kommen etwa 500 Mio. Euro von Unternehmen. Neunzig
Prozent der Kulturausgaben werden in Deutschland vom Staat aufgebracht,
etwa 45 Prozent davon je von den Kommunen und den Ländern, zehn
Prozent vom Bund. Am Gesamtetat liest sich der Anteil zwar bescheiden:
2,4 Prozent der Gemeindehaushalte, kaum zwei Prozent der Landeshaushalte
sind Kulturposten. In den USA werden nur zehn Prozent der Kulturförderung
durch den Staat aufgebracht, in Großbritannien gibt es jährlich
„nur“ 1,5 Mrd. öffentliche Mittel, auch nicht mehr
als 200 Mio. Euro von Unternehmen. Das Ausmaß der staatlich garantierten
Kultur in Deutschland sucht seinesgleichen, und auch das unternehmerische
Engagement nimmt im Vergleich eine herausragende Stellung ein. Deutschland
ist, was die Finanzierung angeht, ein Kulturstaat.
Politik ist nicht für Kultur verantwortlich, wohl aber für
die Bedingungen, unter denen sie stattfindet. Kulturpolitik, so wie
sie im Bundestag, im Kanzleramt und in den Staatskanzleien der Länder
betrieben wird, ist ein pragmatischer Kampf um Haushaltstitel und Stellenpläne,
eher Handwerk denn Erzeugung von Visionen. Allerdings interessieren
sich immer weniger Staats-Bürger für kulturpolitische Streitereien.
Zu abseitig erscheinen die Probleme oder die Blamage ist nicht weit:
siehe Rechtschreibreform. Michael Naumann beklagte, über der deutschen
Kulturpolitik läge „ein Ruch von Vergeblichkeit“. Der
Ton ist unterdessen schärfer geworden: Auswärtige Kulturpolitik,
Diskussion über ein Gedenkstättenkonzept, das stärker
das Gedenken an die Opfer der SED-Diktatur einbezieht, Neujustierung
der Erinnerungskultur, Berliner Stadtschloß, Föderalismus-Reform,
Erhalt der deutschen Sprache, Denkmalpflege vs. Medienförderung.
Die Verteilungskämpfe werden härter, und die Meinung gewinnt
Raum, mittels Kulturpolitik könnten Machtdiskurse gesteuert werden.
Die Ausrichtung der Politik an den Medien, an der Unterhaltung, am
Spektakel hat immense Bedeutung gewonnen. Unmittelbarkeit fehlt beinahe,
viele Vermittlungsinstanzen beeinflussen die Wirkung. Es hat sich eine
Verschiebung weg von parteigestützter hin zu mediengestützter
Legitimation vollzogen. Politik ist personalisiert. Das Vermögen,
Stimmungen zu evozieren und die Presse zu beherrschen, entscheidet.
Vor zehn Jahren wurde die Zahl der Doktorandenstipendien für die
Max Planck Gesellschaft um ein Viertel gekürzt. Die Professoren
in Harvard und in Stanford freuten sich über motivierte Doktoranden
aus Germany. Die meisten blieben drüben. Jacob Burckhardt schrieb
über die Macht: „Nur an ihr, auf dem von ihr gesicherten
Boden, können Kulturen des höchsten Ranges emporwachsen.“
Wieviel Macht hat unser Staat? Wieviel Zukunft hat diese Gesellschaft?
Diese Kultur? Zuerst wollen die Deutschen keine Kinder zeugen, dann
wollen sie nicht sterben, und die Besten wandern aus. 2005 verließen
so viele Deutsche das Land wie niemals seit den späten 1940er Jahren.
Was treibt heute fast 150.000 Menschen jährlich fort? Es sind zumeist
junge, begabte, leistungsbereite Deutsche, die ins Ausland gehen: auf
Dauer. Sie spüren, daß tatsächliche Lähmung das
Land erfaßt hat. Sie haben die arrivierte Looser-Haltung satt,
entziehen sich dem Stillstand. Immer weniger junge Leute sollen immer
mehr Alte versorgen mit ihren Steuern und Sozialbeiträgen, sie
sollen aus dem Gesparten für sich selbst sorgen, und was sie bis
sparen können, verspricht ihnen der Staat noch wegzusteuern. Die
Staatsquote in Deutschland liegt bei mehr als fünfzig Prozent.
Der Staat holt sich das meiste Geld und verteilt es um. Soziale Marktwirtschaft
degeneriert zum Sozialismus. Umverteilt wird durch Steuerpolitik, durch
Subventionen, durch Sozialversicherungen, durch Sozialleistungen. Die
Steuer- und Abgabenlast erstickt die Zukunft, der Sozialstaatsapparat
ist nicht mehr finanzierbar, längst stehen nicht mehr allein die
freiwilligen Aufgaben in Frage.
Im Wort Bildung steckt die mystische Tradition, wonach der Mensch
das Bild Gottes, nach dem er geschaffen ist, in seiner Seele trägt
und in sich aufzubauen habe. Klassische deutsche Bildung hatte viel
von dieser Doppeldeutigkeit bewahrt: Nachbild und Vorbild zugleich sein.
Wilhelm von Humboldt schrieb: „Der wahre Zweck des Menschen [...]
ist die höchste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu
dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerläßlichste
Bedingung.“ Auf dieser freiheitlichen Selbstbildungsidee ist das
reform-humanistische Erziehungssystem in Deutschland gebaut worden.
Nach der Niederlage 1806 sagte der preußische König, man
solle nun durch geistige Anstrengung wettmachen, was man an physischer
Kraft verloren habe. Der Plan ging auf. Es gehörte seit dem späten
18. Jahrhundert in den deutschen Staaten zum Ethos, die allgemeine,
die Volksbildung anzuheben, die technische Ausbildung zu verbessern
und das Hochschulstudium aufzuwerten: die Universitäten galten
bald als die besten der Welt. Heute herrscht Nivellierung nach unten.
Die Reformuniversität ist als Massenanstalt in den Niederungen
angekommen. Ausländer lernen bei uns, weil es nichts kostet. Wer
sich entwickeln will, zahlt und studiert woanders.
Angesichts der Verschuldung schwinden die Gestaltungsmöglichkeiten,
Prioritäten werden nur verbal gesetzt. Die Institutionen trocknen
im Grunde aus, werden allenfalls rhetorisch bewässert. Labile Bonsais
gedeihen. Politischer Minimalismus tendiert zum Nihilismus werden, Etatismus
zum Sozialamtsdenken. In Hannah Arendts „Vita activa“ heißt
es, die Bedrohung der Freiheit in der Gesellschaft komme nicht mehr
vom Staat, sondern von der Gesellschaft selbst. Die Inhumanität
liebt den Schein der Humanität, die Intoleranz den der Toleranz.
Eine Welt der Stimmungen? Oder wie nennen wir das? Eine Verständigung
über die Phänomene wäre vielleicht herzustellen: Pluralität
von Meinungen, Werten und Handlungsweisen, Permissivität, intellektuelle
(Narren-)Freiheit, beschleunigter Wandel der Lebensformen, Auflösung
von Hierarchien, totaler Egalitätsanspruch, Abbau von Bindungen,
Verlust an Traditionalität, kulturelle Globalisierung, Nachlassen
von festen Überzeugungen, Profanität, (scheinbare) Komplexität,
Funktionalität und grenzenlose soziale Mobilität, ein seltsames
Wechselspiel von Individualität und Uniformität, von Selbstentfaltung
und faktischer Vermassung, die Überzeugung grenzenloser Evolution,
zugleich Tendenzen der Ästhetisierung, der Wiederverzauberung...
Ist die bürgerliche Moderne zu Ende? Ist unsere Massendemokratie
als postmoderne Gestalt zu charakterisieren? Welche Kulturpolitik verlangt
ein solches Gebilde?
Die Förderung und Pflege von Kunst und Kultur in Deutschland
ist vorrangig Aufgabe der Länder und Kommunen. Förderung und
Pflege bedeuten Finanzierung. Thüringen hat elf Theater, teilweise
mit Orchestern, 180 Museen, von den 22 institutionell gefördert
werden, 329 öffentliche Bibliotheken, 26 Musikschulen, 6 Staatsarchive,
ca. 30.000 Bau- und Bodendenkmale, vier Stiftungen. Der Landeshaushalt
2005 betrug 9,3 Mrd. Euro, der Kulturetat 124 Mio. Euro: das sind 1,3
Prozent. Diese Kulturquote ist besser als diejenige der meisten west-
und süddeutschen Länder; sie liegt in Nordrhein-Westfalen
bei 0,6 Prozent. Nur das „Geberland“ Bayern leistet sich
im Verhältnis so viel wie wir, allein die Sachsen mehr. Thüringen
gibt, gemessen am Gesamthaushalt, mehr für Kultur aus als Baden-Württemberg
und viel mehr als Hessen oder Niedersachsen und sehr viel mehr als Berlin.
Anders als wir: kulturarm, aber sexy. Ähnlich sieht es bei den
Theaterzuschüssen pro Kopf der Bevölkerung aus: Im Bundesdurchschnitt
werden 12 Euro ausgegeben, bei uns liegt der jährliche Theaterzuschuß
pro Einwohner bei 29 Euro. Weiter: Sachsen 15,5 Euro, Bayern 13 Euro,
Berlin 9 Euro, NRW sogar nur wenig über 2 Euro. Unsere Standards
sind deutlich besser als die derjenigen Länder, die uns aushalten.
Teilungskosten. Der Freistaat gibt jährlich die Hälfte des
Kulturetats für die kommunalen Theater und Orchester aus. Eine
Theaterkarte wird in Deutschland im Schnitt mit 90 Euro Steuergeldern
gefördert, in Thüringen sind es 125 Euro, in Erfurts neuer
Oper sogar mehr als 170 Euro. Auslastung und Einspielergebnisse liegen
mit weniger als zehn Prozent deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.
Für die Rolling Stones darf man für eine Ticket bis zu 190
Euro ausgeben, für Eric Clapton kaum weniger. In Thüringen
kostet eine Theaterkarte im Durchschnitt nicht mehr als dreißig
Euro. Der Staat subventioniert. Woher dieser Anspruch der „bürgerlichen
Hochkultur“ an die Allgemeinheit? Inwiefern ist die Position wider
die Popularität zeitgemäß? Warum sponsert der Staat
die Aufführung zwei Jahrhunderte alter Sinfonien und redet von
Zukunft? Selbstredend, weil Mozart unsterblich, Goethe klassisch-aktuell
ist. Spricht das nicht zugleich für die latente Impotenz zeitgenössischen
Schaffens? Warum arbeiten sich Regisseure immer wieder an „alten“
Texten ab, warum ist das Neue so hämisch infantil? Wir haben uns
längst im Antiquarischen, im Sekundären gemütlich eingerichtet.
Alles vertrottelt sich avantgardistisch in der Information, im Spektakel,
im Skandälchen, im Aufgewärmten und Abgestanden. Zeitgeist-Byzantinismus.
Trotzdem: Wir leisten uns staatsgemäß Hochkultur, bekennen
uns damit zur Hierarchie, mögen die Distanz zum Bierfest nicht
in Gänze aufzugeben. Unerotische Abwehrschlacht zugegebenermaßen.
Bekenntnis zum Anachronismus. Wider den Untergang des Abendlandes etc.
Denn neue Barbaren sind globaliter unterwegs. Es gilt, den Kontinuitätsbruch
zu vermeiden. Bewahrung, denn wer weiß, was kommt. Aber es gibt,
so Nietzsche, auch einen „Grad von Wiederkäuen, bei dem das
Lebendige zu Schaden kommt, und zuletzt zu Grunde geht, sei es nun ein
Mensch oder ein Volk oder eine Cultur“. Cosi fan tutte. Thüringen
hat im Bundesländervergleich die meisten Theaterplätze: 25
Plätze auf 1.000 Einwohner, zweieinhalbmal soviel wie im Bundesdurchschnitt.
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Aber er lebt vor allem vom Brot.
„Hochkultur“ ist eine Konfiguration der Verschwendung, ein
Ergebnis der Freiheit, der Negation des Notwendigen. Kann und will dieser
Staat – fragwürdiger noch: will diese Gesellschaft sich höchste
Freiheit leisten? Aus Einsicht in die Notwendigkeit?
Gottfried Benn schrieb in seinem großen Essay Dorische Welt:
„Man kann sie nebeneinander sehen, die Macht und die Kunst, wahrscheinlich
ist es für beide gut, es einmal durchzuführen: die Macht als
die eiserne Klammer, die den Gesellschaftsprozeß erzwingt, während
ohne Staat im natürlichen bellum omnium contra omnes die Gesellschaft
überhaupt nicht in größerem Maße und über
den Bereich der Familie hinaus Wurzeln schlagen kann.“ Benn drückt
es so aus: „… der Staat, die Macht reinigt das Individuum,
filtert seine Reizbarkeit, macht es kubisch, schafft ihm Fläche,
macht es kunstfähig. Ja, das ist vielleicht der Ausdruck: der Staat
macht das Individuum kunstfähig, aber übergehen in die Kunst,
das kann die Macht nie.“ Kunst bleibe eigengesetzlich und drücke
nichts als sich selbst aus, denn „Stil ist der Wahrheit überlegen,
er trägt in sich den Beweis der Existenz“.
Künstler, Kulturmacher rufen mehr denn je nach der Kraft des Staates.
Im Juli 2006 begannen die Gespräche des Thüringer Kultusministeriums
mit den 26 Trägern der Theater und Orchester im Freistaat. Daß
der Landeshaushalt nur zu weniger als der Hälfte durch Steuern
und ansonsten durch Zuweisungen anderer Länder, des Bundes und
der EU sowie aus Krediten finanziert ist, gehört zu den Rahmenbedingungen.
Woher nimmt Thüringen weiterhin die unsolidarische Kraft, pro Einwohner
aus dem Landeshaushalt für Kultur mehr als doppelt so viel wie
Bayern und fast dreimal so viel wie Baden-Württemberg auszugeben?
Bedeutet die Kulturförderung nichts anderes als die Förderung
bildungsintensiver Arbeitsplätze? Subvention als Investition! Das
Preis-Leistungs-Verhältnis von Kultur ist tatsächlich unschlagbar.
Wieso jedoch wird eine bestimmte Kultur finanziert? Längst macht
bei denen, die nicht am „System“ partizipieren, das Wort
von der Subventionskultur die Rede. Und es geht nicht um bloße
„Breitenkultur“, nicht nur um „freie“ Theater,
Tage neuer Musik, Jazzmeilen, Klezmerwochen, Lesenächte, „Kleinkunst“-Bühnen...
Maler, Bildhauer, Schriftsteller, Übersetzer – sie alle müssen
sich auf dem Markt verkaufen, leben von Stipendien, bewerben sich um
subventionierte Ateliers. Ein unschönes Getriebe. Bei sinkenden
Kulturausgaben wurden in den letzten Jahren nur die Landesmittel für
Theater und Orchester nicht gekürzt. Überkommenes Bekenntnis
zur bürgerlichen Moralanstalt oder zu eine besonderen europäischen
Geselligkeitsform? Ja! Aber solch ein Bekenntnis setzt eine ästhetische
und kulturgesellschaftliche Entscheidung, einen Wille zur sozialen Ungerechtigkeit
voraus. Umverteilung im Etat, Neujustierung ist gleichwohl angesagt.
Mit dem Haushalt 2005 flossen 53 Prozent der Kulturausgaben des Landes
Thüringen in die Theater- und Orchesterfinanzierung, 1995 betrug
der Anteil noch 38 Prozent. Derzeit stehen für Projektmittel lediglich
vier Prozent des Landeskulturhaushalts zur Verfügung.
Leere Theater, schnell abgesetzte Inszenierungen, inhaltliche und formale
Krisen, leseschwache, einfallsarrogante Regisseure, geschwätzige
Nichtsagendheit. Dirty rich und der Applaus der Sitzenbleiber. Der selbstvergessene
Apparat feiert sich selbst, ein Milieu igelt sich ein und glaubt tapfer
an sein Wichtigsein. Draußen wird es kaum mehr ernstgenommen.
Geld kommt noch. Trallala im Feuilleton. Alles lang analysierte und
breit diskutierte Zustände. Abgeschrieben – und doch unverzichtbar.
Melancholie ist es, die uns immer wieder ins Theater gehen läßt.
Bürgerliche Kultur? Racine deklamieren heißt Racine verstehen.
Das setzt Mühe, Anstrengung, tiefe Affinität voraus, erfordert
Ehrfurcht bei der Arbeit im Weinberg des Textes. Die Logik unserer hedonistischen
Massendemokratie egalisiert alle kulturellen Elemente; die Emanzipationen
des späten 20. Jahrhunderts haben die Gesellschaft in eine flexible
Ansammlung von Produzenten und Konsumenten verwandelt, sprich: entbürgerlicht.
Zuvörderst kulturell. Die modern-bürgerliche Welt ordnete
die Spannungen von Individuum und Gesellschaft, Eigennutz und Gemeinnutz,
Bildung und Können, Kunstwerk und Stil, also das Einzelne und das
Ganze, harmonisch an. Sie beerbte das hierarchische Denken Alteuropas
und transformierte es in liberale Formen. Die Identitäten bürgerlicher
Kultur bieten keinen Halt mehr. Übriggeblieben sind lose Elemente,
die unter rein funktionellen Aspekten kombiniert werden können.
Wir sehen die weltweite Durchsetzung einer uniformen Massen- und Medienkultur.
Was heißt da und zu welchem Ende betreibt dieser Staat Hochkulturpolitik?
Der Ruf nach dem Staat wird allenthalben lauter, die Erwartungen an
ihn sind ebenso hoch wie widersprüchlich. Was soll er dem Einzelnen
bieten? Gibt es noch ein Eigenrecht des Politischen gegenüber dem
Ökonomischen und Sozialen? Der alte Liberalismus war ein ausgeklügeltes
System der Freiheitssicherung, gegen staatliche und gegen wirtschaftliche
Macht, war staatsskeptische Ordnungspolitik. Er basierte auf dem Zusammenhang
von Optionen und Ligaturen. Um frei zu sein, braucht der Mensch nicht
nur Wahlmöglichkeiten, sondern auch Koordinaten. Er braucht Halt,
Bindungen. Das eben vermittelten gewachsen gesellschaftliche Institutionen,
nicht zuerst der Staat: Familie, Gemeinde, Tradition, Kirche, Schicksalsgemeinschaft,
Nation – und die ererbte Kultur, hohe, festliche wie alltägliche.
Da diese Institutionen lustvoll-suizidal geschliffen werden oder worden
sind, soll der Staat nun alle (finanziell) substituieren. Als letzte
Institution soll er rasant wechselnde neue Systeme und viele Anachronismen
stützen. Postmoderne und totaler Staat: das wäre ein Thema.
Wo ist das Maß der Kulturstaatlichkeit in einem Land, das keine
kantige Kulturkritik mehr kennt? Wie plausibel ist der Widerstand, wer
wagt die fundamentale Störung? Nach Redlichkeit und Glaubwürdigkeit
mag man nach den Fällen Jens, Grass etc. in diesem Land nicht fragen.
Nach intellektueller Verantwortung schon gar nicht. Das Versagen einer
ganzen egoistischen „Klasse“ im Einigungsprozeß ist
nicht vergessen. Gerade die Intellektuellen haben in Deutschland nichts
so eloquent angegriffen wie den nationalen Kulturstaat, die bürgerliche
Gesellschaft. Deren Auflösung wurde von der ästhetischen Avantgarde
inbrünstig gefordert, auf den Bühnen exzessiv performiert.
Woher jetzt die Jammerei? Der Staat zieht sich zwangsweise zurück,
taugt als Gegner nicht mehr. Er wird Intellektuellen und Künstlern
auch als Mäzen abhanden kommen. Später.
Der finanzielle Rahmen des Landes Thüringen hat sich in den jüngsten
Jahren nicht verbreitert. Im Gegenteil, mit der Bestätigung des
Solidarpakts II bis 2019 kann die Reduzierung des Landeshaushalts prognostiziert
werden. Das Volumen von 9,3 Mrd. Euro wird bis 2019 dramatisch sinken,
und zwar um ein Drittel. Dieser Entwicklung wird sich, auch wenn der
Autor und Kulturpolitiker sich melancholisch anderes wünscht, kein
Etat verschließen können. Wie die gegenwärtigen Verhandlungen
– es liegt ein Angebot des Landes vor, die Träger sind am
Zug – auch ausgehen, der Kulturetat wird zumindest nicht wachsen.
Die Theater sind, abgesehen von Meiningen, in der Trägerschaft
der Kommunen; das Problem entsteht ohnehin und vor allem dort. Dem DNT
Weimar etwa fehlen ab 2009 allein 2,5 Mio. Euro wegen der anstehenden
Tarifanpassungen. Die geplanten Landeskürzungen machen 1,5 Mio.
Euro aus. Das heißt: Ohne Änderungen im Netz der kulturellen
Einrichtungen und stärkere Stringenz der Förderstrukturen
ist der Sektor nicht zukunftsfähig. Oder wir richten uns im flächendeckenden
Mittelmaß ein. Auch das wäre eine Thüringer Option.
Sie wird nicht selten gefordert. Lässiges Bekenntnis zur Provinz.
Masse und Breite statt Klasse. Wer mag und kann noch differenzieren.
Bei einem Anteil der Personalkosten an den Theaterausgaben von 83 Prozent
sowie durchschnittlichen jährlichen Personalkosten von 45.000 Euro
pro Hoch-Kultur-Beschäftigten, entspräche die Reduzierung
der Landesförderung einer rechnerischen Personaleinsparung von
über 200 Beschäftigten. Schon dies wird notwendigerweise zu
veränderten Ensemble-Strukturen führen. Hinzu kommen die tarifbedingten
Aufwüchse der Kosten. Eine entblößende Qualitätsdiskussion
steht ins Haus. Einige Theater haben in den letzten Jahren Einsparungen
über Haustarifverträge realisiert. Probleme wurden damit verschoben.
Die Moratorien enden. Einkommensrückstände würden über
einen Zeitraum hinweg zu Qualitätsabstrichen führen. Cui bono?
Die Theaterdiskussion wird von Schützengräben aus geführt.
Ideenreichtum ist nicht erkennbar. Zunächst, es geht nicht um „die“
Kultur, es geht um ein bestimmtes, an staatliche Alimentierung gewöhntes
Segment. Es geht um Angebote für Minderheiten – und für
immer älter werdende Touristen. Ein Informationsblatt des Bundeskulturministeriums
(schon aus dem rot-grünen Jahr 2002) verabschiedet sich schneidig
vom Konzept „Kultur für alle“ der 1970er Jahre: „Die
engere Bindung der Kultur an den Lebensalltag ist mitunter mit einer
Verflachung des kulturellen Angebots erkauft worden. Problematisch erscheint
heute vor allem die damalige Grundannahme, es gebe eine Kultur, die
sich allen Schichten erschließt.“ In der Praxis ist das
stets bestätigt worden, es geht nicht um Preise, es geht um Relevanz.
Als der Berliner PDS-Kultursenator Flierl jüngst mit Bussen Hartz-IV-Empfänger
abholen und in die Linden-Oper fahren wollte, kam er mit weit mehr Fahrzeugen
als Insassen zurück. Also stürmen wir wenigstens diesen Graben,
er ist längst leer.
Und wie weiter? Wir wissen um die marginale Bedeutung des Theaters,
die Altersstruktur der Orchester-Besucher, die Anzahl der monatlichen
Konzerte, die Auslastungen, die Einspielquoten, die ästhetische
Innovation. Hans Magnus Enzensberger hielt im August 2006 eine Tischrede
beim Treffen des Ordens Pour le Mérite; er sagte: „[…]
und so leistet sich jedes Residenzstädtchen bis heute sein Theater,
sein Orchester, sein Museum, das eine oder andere Festival und manche
andere Annehmlichkeiten. Wenn der Bund es nicht richtet, wird es schon
das Land oder die Gemeinde tun.“ Enzensberger weiter zu Oper,
Orchester, Theater: „Auch in diesem Fall wird man jedoch daran
erinnern dürfen, daß die Fütterung von Künstlern
nicht zu den Geboten unserer Verfassung gehört. Wer Theater spielen,
Installationen hervorbringen oder Gedichtbände schreiben will,
sollte sich darüber im klaren sein, daß er sich auf höchst
riskante Tätigkeiten einläßt. Für den Fall, daß
er mit seiner Arbeit kein Auskommen findet, sollte er darauf verzichten,
sich beim Staat zu beklagen. Jammernde Künstler sind kein schöner
Anblick.“ Enzensberger rät, sich von der Verbeamtung der
Kultur zu verabschieden: „Die Tätigkeiten, um die es sich
hier handelt, stehen dem Dienstrecht fern; sie kennen keine Pensionsansprüche,
keinen Bundesangestelltentarif und keine Garantien. Lassen Sie deshalb
in Ihrer ministeriellen Güte Zeitverträge walten, vertreiben
Sie die Gewerkschaften aus dem Musentempel, geben Sie den Leuten Autonomie,
und verabschieden Sie sich von dem häßlichen Laster des Kameralismus.“
Wir stehen vor neuen kulturpolitischen Debatten, die sich an der dekadenten
Wirklichkeit orientieren und Versäumnisse der Vergangenheit anerkennen
müssen. Was fällt unter Kultur? Wie stark muß die Kultur
staatlich gefördert werden? Die bürgerliche Gesellschaftstheorie
band das Individuum an überindividuell-normative Instanzen, das
Individuum im postmodernen Kontext erscheint von jeder substantiellen
Bindung losgelöst. Nur die möglichst totale gesellschaftliche
Atomisierung gestattet extreme Flexibilität.
Das Verhältnis Staat – Kultur wird neu überdacht werden
müssen, nicht nur wegen der existentiellen Finanznöte der
öffentlichen Haushalte, sondern auch wegen der rasanten gesellschaftlichen
Veränderungen, wegen der fehlenden kulturellen Dissidenz gegenüber
der Dekadenz, wegen der sich verändernden Rezeptionsweisen, wegen
der siechen Schicht Bildungsbürgertum. Wir werden uns an uncharmante
Leitbegriffe gewöhnen müssen: Kulturwirtschaft, -stiftungen,
-sponsoring. Eine Thüringer Kultur-Konzeption wird eine spröde
Einordnung der Kultur als Wirtschaftsfaktor beinhalten müssen:
Kultur schafft Arbeitsplätze, bringt Touristen ins Land, gibt Anreize
für Investoren. Tatsächlich, der Tourismus in Thüringen
erzielte 2004 einen Umsatz von 2 Mrd. Euro (und ist mit der Automobilzulieferindustrie
ungefähr auf gleicher Höhe). Der Städtetourismus ist
ein Zukunftsmarkt. Der Kulturetat macht 6,3 Prozent des Tourismus-Umsatzes
aus. Allein die Mehrwertsteuer beträgt 270 Mio. Euro. Kultur ist
als wichtiges Fundament des Tourismus ein Wertschöpfungsfaktor.
Und also verlagern wir die Kulturdiskussion am besten pragmatisch in
das Wirtschaftsressort.
Weltbilder wurzeln in nicht vollständig begründbaren Dezisionen.
Sie werden vom Selbstbehauptungswillen dominiert und rhetorisch umschleiert.
Vernunft dient keineswegs dazu, das Machstreben zu überwinden,
sie ist Teil desselben. Politische „Kommunikation“ ist nie
interesselos, auch die Ansprüche der ratio sind wie jene der Moralität
– mehr oder weniger erkennbar – aggressiv. Unsere gegenwärtige
Kulturdebatte ist nicht prinzipiell oder phänomenal, sondern rhetorisch.
Sie fragt nicht nach dem Wesen der Sache.
Es gibt einen Essay Ortega y Gassets aus dem Jahr 1932: Um einen Goethe
von innen bittend. Darin heißt es: „Das Leben ist seinem
inneren Wesen nach ein ständiger Schiffbruch. Aber schiffbrüchig
sein heißt nicht ertrinken. Der arme Sterbliche, über dem
die Wellen zusammenschlagen, rudert mit den Armen, um sich oben zu halten.
Diese Reaktion auf die Gefahr seines eigenen Untergangs, diese Bewegung
der Arme ist die Kultur […]. Solange die Kultur nichts ist als
dies, erfüllt sie ihren Sinn, und der Mensch steigt auf über
seinem eigenen Abgrund.“ Ortega schreibt weiter, er glaube nur
an die Gedanken Schiffbrüchiger. Man sollte die Klassiker vor ein
Tribunal von Schiffbrüchigen stellen und sie gewisse Urfragen des
Lebens beantworten lassen. Kultur als Kulturwirtschaft legitimiert:
das ließe sich eine Zeitlang finanzieren, aber im Grunde wäre
es Sterbehilfe.
Der Thüringer Landeshaushalt befindet sich in einer schwierigen
Lage. Vom Auslaufen der Osttransfers war die Rede. Und seit drei Jahren
bleiben die Steuereinnahmen hinter den Erwartungen zurück, eine
Folge der wirtschaftlichen Situation, in der sich Deutschland befindet.
Düstere Faktoren bestimmen die Seite der Einnahmen in Thüringen.
Da ist die demographische Entwicklung: der starke Bevölkerungsrückgang,
der zu weniger Steuereinnahmen und zur Zunahme der Pro-Kopf-Verschuldung
führt. Thüringen wird 2020 nur noch etwa 2 Mio. Einwohner
haben, das sind 11 Prozent weniger als heute. Und die Bevölkerung
wird älter, das Erwerbspotential schmilzt. Thüringen zahlt
täglich 1,8 Mio. Euro Zinsen. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei
fast 6.000 Euro; nimmt man die Kommunen hinzu, nähern wir uns den
8.000 Euro. Im Landeshaushalt liegt die frei verfügbare Masse bei
260 Mio. Euro, das sind drei Prozent. Alle anderen Mittel sind gebunden
durch Bundes- und Landesgesetze oder langfristige Verträge. Der
Sozialstaat fordert seinen unermeßlichen Tribut. Allein für
Sonderrenten aus DDR-Systemen gehen dreistellige Millionen-Beträge
weg, sehr viel mehr als der Kultur- oder der Kindergarten-, selbst als
der Hochschul-Etat. Und wir haben zuviel Beschäftigte im öffentlichen
Dienst (25 für 1.000 Einwohner, in den alten Ländern sind
es 20); wir geben, so wirft eine neue Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung
dem Freistaat vor, zu viel Geld für Kultur und Bildung aus. Das
Land ist zu drastischen Sparmaßnahmen gezwungen. Die Studie von
Helmut Seitz verlangt nicht zuletzt den Abbau der „flächendeckenden
Topstandards in Kultur und Bildung“.
Der Sozialstaat hat Erwartungen geweckt, die sich auf Dauer nicht erfüllen
lassen. Die Staatsausgaben müssen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt
deutlich gesenkt werden, der Staat darf nicht mehr alle Aufgaben übernehmen,
die der Einzelne oder die jeweils kleinere Gemeinschaft erfüllen
kann. Die Haushaltslage stellt das Land vor große Schwierigkeiten,
aber erhöht den Druck, sich vom Illusionismus zu verabschieden.
Wirklichkeit läßt sich nicht beliebig konstruieren. Die Thüringer
Landesregierung hat das Ausgabenniveau von 1998 bis 2007 bereits deutlich
gesenkt und wird bis zum Ende der Legislaturperiode 13 Prozent der 2005
noch ausgewiesenen Personalstellen im Landeshaushalt „eingesparen“.
Neben den rund 400 Stellen, die bis 2009 in den obersten Landesbehörden
wegfallen, werden im nachgeordneten Bereich rund 7.000 Stellen gestrichen.
Es geht um ein neues Verhältnis von Staat, Wirtschaft, Gesellschaft,
um die Entwicklung von Mäzenatentum und privaten Stiftungen. Welche
Kultur werden sie fördern? Kommt es in der Krise zu einer Revitalisierung
des Bürgerlichen? Die kulturrevolutionäre Individualisierung
hat wohl mit Vielfalt, Reichtum an Unterschieden, Differenz wenig zu
tun. Sie schafft im Gegenteil, bei aller Beweglichkeit im Detail, blähende
Monotonie und Alternativlosigkeit, eine dümmliche Langeweile. Das
Besondere, Einmalige, Unverwechselbare entzieht sich. Die durchindividualisierte
Gesellschaft bezahlt die Fülle der Optionen im einzelnen mit gesichtsloser
Uniformität im ganzen. So gibt es denn auch nichts Eintönigeres,
Konventionelleres als jene Nonkonformität, die die Emanzipationspropheten
für das Endziel der Erziehung des Menschengeschlechts halten. Auch
der spät- und postmoderne Pluralismus hat ein Selbstverständnis,
das möglicherweise als ideologisch zu bezeichnen ist: ein Weltbild
wird verabsolutiert. Und keine Kulturkritik begehrt gegen die Trostlosigkeit
und ästhetische Vergessenheit auf. Botho Strauß schrieb klug:
„Der Widerstand ist heute schwerer zu haben, der Konformismus
ist intelligent, facettenreich, heimtückischer und gefräßiger
als vordem, das Gutgemeinte gemeiner als der offene Blödsinn [...].“
Warum mangelt es an einer desillusionierenden, radikalen und vor allem
konsequenten Kultur-Kritik? Fällt der Abschied von feisten, utopistischen
Doktrinen zu schwer? Welche Berechenbarkeitsgarantien haben die Konstrukte,
die unsere Kultur schildern? Die gesellschaftliche Fragilität,
die seit eh und je den dunklen Leidenschaften des Menschen angelastet
wird, läßt sich nicht ausschalten. Der absolute Pluralismus
und Humanitarismus lebt aus einem evolutionistischen Optimismus. Doch
erfaßt eine Wunschanthropologie die Realitäten dieser Welt
hinreichend? Stellt sich unter den Bedingungen der hochtechnisierten,
partyverwöhnten Massengesellschaft die Frage nach dem Wesen des
Menschen und den Möglichkeiten der Kultur nicht schärfer denn
je? Der Zerfall der alten Ideologien bedeutet nicht das Ende der Kämpfe
zwischen sozialen Gruppen, Staaten. Menschliches Verhaltens beruht auf
Konstanten, unter denen das Streben nach Selbsterhaltung (auch durch
Machtsteigerung) nicht das Unwichtigste sein mag. Innerhalb einer offenen
Weltgesellschaft wird das Problem des sozialen Zusammenhalts weiter
bestehen – und es kann jederzeit eine ungeahnte Schärfe annehmen.
Und es wird um Kultur gehen.
Die fortschreitende Mediengesellschaft hat keinen Sensus für irrationale
Bestätigung. Sie schafft alle unökonomischen, unnützen
Bindungen ab zugunsten der totalen Gegenwart. Nietzsche hat uns gelehrt,
daß eine Kultur beides nötig hat: das Unhistorische wie das
Historische. Wir reden autistisch über staatliche Kulturfinanzierung,
konservieren Kultur, weichen den bedrängenden Fragen aus.
„Der letzte der Maskierten bleibt einen Augenblick stehen und
erkennt Minetti und zeigt mit dem Zeigefinger auf ich ruft Der Künstler
Der Schauspielkünstler und läuft weg. Minetti bleibt bewegungslos,
bis er vollkommen zugeschneit ist. Ende.“ (Thomas Bernhard)
Wir brauchen den Staat als Schutzraum; die bürgerliche Kultur
allein ist zu altersschwach, moribund, ausgezehrt. Sie ließ sich
nie durch Mehrheiten bestätigen, lediglich finanzieren. Sie hat
sich nun, die Zeiten ändern sich, trotz ihres Zustandes als elitäre
Kultur zu legitimieren. Jedes Bekenntnis zu ihr erfordert Wahrhaftigkeit
und ein Erkenne die Lage. Identität ist kein Modewort, das sich
justament revitalisieren ließe. Die deutsche Nation hat sich noch
vor territorial-staatlicher Einigung und demokratischer Verfassung als
Kulturnation verstanden. Kultur hat einen eigenständigen Freiheitsraum
erzeugt. Unsere Kultur ist untrennbar – ob bewußt die unbewußt,
ob gewollt oder bekämpft – mit der Identität als Nation
verbunden. Und sie ist mit Europa verbunden. (Früher wagte man,
Abendland zu sagen.) Nun ist Identität nicht alles, aber ohne Identität
ist Kultur nichts. Es kommt nicht vorn ungefähr, daß die
Kulturnation alle politischen Systeme überdauert hat. Sie hat geholfen,
die vierzigjährige Trennung in zwei deutsche Staaten nicht zu einer
Teilung des Volkes werden zu lassen. Unsere Kultur als besondere zu
benennen und wegen ihrer Bedeutung zu verteidigen, ist Aufgabe des Staates
und ist Aufgabe der „Kulturschaffenden“, also jener, die
in den jüngsten Jahrzehnten lieber sich selber verteidigt und verwirklicht,
dabei willentlich an dem Ast gesägt haben, auf dem sie saßen
und sitzen.
In der historischen Leere fehlt die Richtung, ohne Woher gibt es kein
Wohin. Kulturelle Zukunft ist Herkunft. Michael Stürmer rechnet
ab: „Seitdem die 68er und ihre Epigonen, in der unheiligen Allianz
mit den Technokraten in den Kultusministerien, den Verbänden und
Parlamenten, die tabula rasa des Nichtwissens, Nichtlernens, Nichterinnerns
herstellten, ist alles gleich, irgendwo im Nebel ferner Vergangenheiten.“
Erinnerung, Zeit, Geschichte seien seit Jahrzehnten zum irrationalen,
unpolitischen Rest abgesunken. In diesem Jahr jährt sich zum 200.
Mal das Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Es
war eine politische Lebensform, eine Kultur, die bis heute deutsche
Mentalitäten, Rechtsformen, Zünfte und Selbstverwaltung, Städtewesen,
die Sprache, die Landschaften geprägt hat. Aber als in Magdeburg
und Berlin große Ausstellungen eröffnet wurden, blieb die
politische Prominenz fern. Erinnerungslosigkeit ist die Demenz, die
eine Kulturnation befällt.
Im August 1946 hielt Winston Churchill in der Schweiz eine Rede über
die Zukunft Europas. Er sagte, es gebe „kein Wiederaufleben Europas
ohne ein geistig großes Frankreich und ein geistig großes
Deutschland“. Ist mit Europa noch zu rechnen? Geistig? Kulturell?
Oder werden andere die Erde erben? Die Diskussion über die „Leitkultur“
war überfällig. Ist Kultur zu definieren – oder ist
sie offensichtlich? Sie muß nicht mit rationalen Argumenten begründet
werden. Der abgewürgte Disput um die Leitkultur verweist auf den
geltenden Begriff des Politischen. Das Gewünschte wird mit der
Realität verwechselt. Es geht nicht um Fakten, es geht um Erwartungen.
Den letzten Bürgern wird eingeredet, Politik habe nichts mit starken
Interessenkonflikten, nichts mit Selbstbehauptung zu tun. Rhetorische
Kultur.
Nietzsche erstrebte die deutsche Einheit als „die Einheit des
deutschen Geistes und Lebens nach der Vernichtung des Gegensatzes von
Form und Inhalt, von Innerlichkeit und Convention“. Uns fehlen
die Kategorien einer Kulturkritik. Adorno war der Denker der metaphysisch-ästhetischen
Sehnsucht nach dem Unbedingten, aber zugleich der bürgerlichen
Spätzeit und der illusionären Entwürfe aus Übermut.
Rhetorik statt Evidenz. Was kam danach? Allenfalls ästhetische
Vollstreckung der satten Weltlichkeit und kleinbürgerlichen Innerlichkeit.
Wir benötigen eine neue Kulturkritik, eine skeptische aus einem
„starken Pessimismus“ (Nietzsche) her. Wo stehen die Marksteine
des kulturellen Zeitbewußtseins? Ausdruck, Form, Geist, Bildung,
Andacht. Stil vor allem! Das Schöne soll sein. Können wir
uns Ironie noch leisten? Wir müssen.
Gerade wegen der intellektuellen Versuchungen zum virtuos-rhetorischen
Umgang mit der Wirklichkeit ist eine historisch abgeklärte Skepsis
gegenüber Visionen und Utopien, ein nüchterner Pragmatismus
und pessimistischer Humanismus, der darum weiß, daß sich
der alte Adam nicht in den Neuen Menschen verwandeln läßt,
nicht die schlechteste Grundlage einer neu-bürgerlichen Kulturkritik
als Fundament einer konservativen Kulturpolitik. Alles andere wäre
Restauration allgemeiner leichtfertiger Banalität, Akzeptanz der
klassizistischen Verstopfung.
Kehrt das politische Subjekt, der Bürger zurück? Gibt es Hoffnung
auf eine neue kulturelle Gründerzeit? Wird die Krise kreative Dissidenz
freisetzen? Ortegas Bild von der Kultur als Schwimmbewegung sei fortgeführt:
„Zehn Jahrhunderte kontinuierlicher Kulturarbeit haben neben nicht
geringen Vorteilen die große Unzulänglichkeit mit sich gebracht,
daß der Mensch sich in Sicherheit glaubt, die Erschütterungen
des Ertrinkens vergißt. Darum muß irgendeine Unstetigkeit
eintreten, welche in dem Menschen das Gefühl des Verlorenseins,
die Substanz seines Lebens, erneuert. Es ist nötig, daß alle
Rettungsringe um ihn her versagen, daß er nichts findet, woran
er sich klammern kann. Dann werden seine Arme sich wieder rettend regen.“
Aus: Palmbaum ~ Literarisches Journal aus Thüringen, Heft 2/2006
Diskussionsrunde in der Goethe Galerie Jena
„Der arme Schiller“
oder:
Was können Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst
einander geben?
Wie im letzten Heft angekündigt, war vom 9. bis 21. Mai 2005 in der Goethe Galerie Jena eine Ausstellung des Palmbaum e.V. zu sehen: „Im Spiel der Zeiten. Der Jenaer Schiller.“ Im Rahmen dieser Ausstellung lud ihr Kurator, Jens-Fietje Dwars, täglich zu Gesprächen über Schillers Erbe im Hier und Heute ein. Die wohl brisanteste Runde fand am 11. Mai statt: Im Zeichen des „armen“, von Schulden und Krankheit gezeichneten Schiller sprachen Alexander von Witzleben (Vorstandsvorsitzender der JENOPTIK AG), Prof. Dr. Klaus Dicke (Rektor der Friedrich-Schiller-Universität Jena), Till Noack (Geschäftsführer der Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH) und Dr. Margret Franz (Werkleiterin von JenaKultur) über die Frage, was Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst einander zu geben vermögen.
Dwars: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße
Sie herzlich zu unserer 2. Diskussionsrunde über die Fragen: ‚Was
sagt uns Schiller hier und heute, welche Probleme kann er uns auftragen?‘
Denn um ein solches geht es heute, um die Frage: ‚Was vermögen
Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft einander zu geben?’ Ist ihr
Verhältnis nur eine Einbahnstraße, so dass der Geist bei
der Wirtschaft betteln muss oder gilt auch umgekehrt, dass sie den Geist
braucht, der eine innovative Lebenssphäre schafft? Sie wissen,
Schiller erkrankte 1791schwer, nachdem er hier in Jena Professor für
Geschichte geworden war. Sachsen-Weimar war ein armes Land. Und so war
es zu unserer Beschämung nicht Carl August, der Schiller gerettet
hat, sondern der Herzog von Holstein Augustenburg. Seiner Ehrengabe
von drei Mal jährlich 1000 Talern verdanken wir nicht nur Schillers
„Briefe zur ästhetischen Erziehung“, sondern vor allem
den „Wallenstein“, das große Drama, das der Dichter
nun, relativ sorgenfrei, schreiben konnte.
Ich begrüße in dieser Runde: Frau Dr. Margret Franz, Werkleiterin
von JenaKultur. Herrn Alexander von Witzleben, den Vorstandsvorsitzenden
der JENOPTIK AG, einen der Sponsoren dieser Ausstellung, die es uns
ermöglicht haben, Ihnen Schiller auf diese Weise näher zu
bringen. Zu meiner Linken Till Noack, der Geschäftsführer
der Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH, gleichfalls ein verlässlicher
Sponsor vielfacher Bemühungen des Palmbaum-Vereins in den vergangenen
Jahren, und Herr Professor Dicke, Rektor der Friedrich-Schiller-Universität,
die den Namen des Dichters seit nun schon mehr als 60 Jahren trägt.
Ich komme gerade aus Wandersleben, wo wir eine neue Gedenkstätte
für einen Barockautor einrichten, und dort traf ich den für
Museen verantwortlichen Sekretär im Kultusministerium. Mit der
Zahl, die er mir genannt hat, möchte ich beginnen: Vor 10 Jahren
standen ihm 59 Millionen DM für 200 Museen zur Verfügung –
in diesem Jahr sind es noch 5 Millionen Euro. Das ist ein großes
Problem. Wie stellt es sich für Jena dar, Frau Dr. Franz?
Dr. Franz: Natürlich stellt sich das auch für Jena
dramatisch dar. Jetzt nicht gerade in punkto der städtischen Museen,
da wir in der glücklichen Lage sind, vom Land keine institutionelle
Förderung zu erhalten und das auch nicht nötig haben. Ich
sage das jetzt vielleicht etwas zugespitzt, aber mitunter ist es auch
ein Segen, wenn man nicht immer von solch einem Geldtopf abhängig
ist, sondern von Mal zu Mal bei Projekten Fördermittel beantragen
kann. Viele andere Museen in unserem Lande haben da viel schwerer an
dieser Bürde zu tragen. Wenn ich an die Heidecksburg denke, die
eine hohe institutionelle Förderung bekommen hat und jetzt natürlich
in schwere Nöte geraten ist. Das ist uns Gott sei Dank erspart
geblieben. Allerdings ist es auch nicht so, dass unser Eigenbetrieb
JenaKultur – wozu die Jenaer Philharmonie, das Volkshaus, die
Kulturarena, die städtischen Museen, die Musik- und Kunstschule,
die Volkshochschule, die Touristinformation und die Stadtfeste zählen
– nicht auf einen Zuschuss angewiesen wäre. Ich möchte
einmal verdeutlichen, wie diese Institutionen, die unter unserem Dach
vereinigt sind, finanziert werden. Der Eigenbetrieb JenaKultur hat über
200 Mitarbeiter und ein Budget von etwa 17 Millionen Euro. Etwa 9 Millionen
schießt die Stadt Jena zu und das Land so gerade mal 2 Millionen.
Also, Sie sehen, dass der Rest selbst erwirtschaftet werden muss. Das
ist natürlich eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, und gerade aus
dem Grund sind wir mehr denn je auf die partnerschaftlichen Beziehungen
zur Wirtschaft und Wissenschaft, zu den hier am Ort ansässigen
Betrieben und Unternehmen angewiesen. Aber ich will nicht in eine große
Jammerei verfallen. Deswegen sind wir heute nicht hier.
Ich bin der Meinung, wenn das Geld der öffentlichen Hand nicht
mehr reicht, dann muss man sich nach anderen Partnern umschauen, und
man muss auch überlegen, neue Strukturen zu wagen. Mit dem Eigenbetrieb
JenaKultur haben wir das getan, und ich sage Ihnen, mir tut es bis heute,
trotz der Diskussionen, die es in der Öffentlichkeit gibt, überhaupt
nicht leid. Nicht eine Sekunde hat es mir leid getan, dass wir jetzt
in der Lage sind, langfristiger zu planen, eigenständiger, eigenverantwortlicher
mit dem Geld umgehen zu dürfen und auch selbst die Personalhoheit
zu haben. Das ist ein großer Vorzug gegenüber der Situation,
in der wir uns vorher befanden. Im Übrigen hatte auch Friedrich
Schiller so seine Probleme, wenn es darum ging, Kunst und Geld miteinander
in Verbindung zu bringen. Auf der einen Seite war er ständig in
Geldnot, auf der anderen aber hat er auch darüber nachgedacht,
ob es denn gut sei, wenn Poeten und Künstler vom Staate besoldet
werden. Ich habe da ein schönes Zitat in einem Brief an Goethe
gefunden, wo er gerade diesen Zwiespalt darlegt. Und zwar schreibt er
am 12. Juli 1799: ‘Die Poeten sollten immer nur durch Geschenke
belohnt, nicht besoldet werden. Es ist eine Verwandtschaft zwischen
den glücklichen Gedanken und den Gaben des Glücks, beide fallen
vom Himmel.’ Daran sieht man, dass er wohl auch darüber nachgedacht
hat, was es denn bedeuten würde, wenn es Kunst und Kultur zu gut
ginge. Vielleicht wären sie dann nicht mehr in der Lage, wirklich
Ideen zu produzieren. Ich will damit natürlich nicht behaupten,
dass wir gar kein Geld bräuchten, das sicherlich nicht. Aber ich
möchte auf diesen Zwiespalt hinweisen, in dem Schiller selbst gelebt
hat.
Dwars: Vielen Dank. Herr Noack, Sie stehen nun auf der anderen Seite, auf der der Sponsoren, und gewiss werden Sie fast täglich eine Flut von Förderanträgen erhalten. Können Sie uns einen Überblick geben, und uns sagen, wie Sie darauf reagieren?
Noack: Ja, bei den Stadtwerken kommen wirklich viele Anfragen an, wobei das nicht alles Fragen nach Sponsoring sind, viele fragen auch nach Spenden. Man muss das, glaube ich, unterscheiden. Das, was Schiller gesagt hat, das hat eine besondere Brisanz. Aber in gewisser Weise gilt das natürlich auch für das Sponsoring. So ein Sponsor hat immer Ansprüche, er will etwas erhalten für sein Geld. Und er will zumindest, dass sein Unternehmen oder das, was er vertritt – in unserem Fall wäre das also die kommunale Energiewirtschaft oder die Wasserversorgung –, nicht in Konflikt gerät mit dem, was er da sponsert. Ein Sponsor hat auch Ansprüche an denjenigen, dem er das Geld gibt. Das sieht anders aus bei Spenden, und das sieht anders aus beim Mäzenatentum. Um ein solches hat es sich ja bei Schiller gehandelt. Und viele der Sponsoring-Anfragen, die wir erhalten, richten sich nicht darauf, den Stadtwerken eine Leistung anzubieten, wie es beim Sponsoring als wirtschaftliches Geschäft zwischen Partnern üblich ist. Nicht: ‘Ich biete Dir ein positives Image, in welcher Form auch immer, zum Beispiel, dass der FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga aufsteigt oder dass die Kulturarena so zum Sommermittelpunkt in Jena wird’, sondern sie sagen: ‘Mir geht’s als Verein so schlecht, bitte gib mir Geld.’ Und da erreichen uns wirklich sehr, sehr viele Anfragen. Wenn die öffentlichen Mittel abnehmen, versuchen die Vereine, sich auf andere Art und Weise über Wasser zu halten. Wir tun da relativ viel, aber wir haben nur ein streng begrenztes Budget, das natürlich bei weitem nicht ausreicht. Und wir achten darauf, dass beim Sponsoring Leistung und Gegenleistung in einem angemessenen Verhältnis stehen.
Dwars: Vielen Dank. Wie reagiert man, wenn sich diese Anträge
häufen? Und wenn man selbst kein wachsendes Budget hat. Eine Möglichkeit
wäre dann das Gießkannenprinzip: Jeder bekommt mal etwas
ab. Oder wagt man zu sagen, wir fördern einen bestimmten Teil von
Kultur, einen anderen Teil fördern wir nicht. Das ist der unbequemere
Weg, für den man Kriterien braucht. Welchen Weg wählen Sie,
Herr von Witzleben?
von Witzleben: Also erst einmal muss man sagen: Für uns
gehört das Sponsoring, in welcher Form auch immer, zu unserem Selbstverständnis
als Unternehmen hier am Standort. Wir sind eingebettet in die Stadt.
Man kann den wirtschaftlichen Erfolg von Jena sicherlich nur verstehen,
wenn man über 100 Jahre zurückgeht, wenn man die enge Verbindung
der hier ansässigen Optikindustrie – die ja heute mehrere
Namen trägt – mit der Universität, mit der Philharmonie
und unter Umständen auch mit Weimar sieht. In Weimar ist ja Carl
Zeiss zum Beispiel geboren worden, was die wenigsten wissen. Deshalb
haben wir gesagt, wir müssen hier vor Ort wirken. In Baden-Baden
oder in Nürnberg oder in München ist unser kulturelles Engagement
nicht notwendig.
Ich bekomme jede Menge Anfragen, aus Passau jüngst, und da habe
ich gesagt, die Münchener Rück ist näher an Passau als
wir. Man war über die Absage natürlich enttäuscht, aber
wir sagen deutlich: Das tun wir nicht. Wir werden hier gebraucht.
Hier müssen wir dann ‘klotzen’ und nicht ‘kleckern’.
Das ist eine ganz klare Strategie. Es bringt mehr, ein Thema vernünftig
über mehrere Jahre mit größeren Beträgen zu unterstützen,
als irgend etwas zu atomisieren, wo dann keiner etwas davon hat. 1000
Euro für ein kleines Projekt zu geben, mag für jemanden viel
sein, aber es nimmt den großen Topf weg, und dadurch bewegt man
nichts mehr. Das ist unsere klare Strategie. Im vergangenen Jahr zum
Beispiel sorgte die Oper ‘Die unendliche Geschichte’ –
diese Uraufführung in Weimar, wo wir auch unsere Technologie mit
einbringen konnten – bundesweit für Furore. In diesem Jahr
war das die Ausstellung in der Nationalgalerie in Berlin, an der auch
der aus Chemnitz stammende Künstler Carsten Nicolai mit einer Technologie
von uns teilgenommen hat. Da haben wir natürlich die Effekte und
deswegen ist ganz klar: Lieber weniger Themen, aber dafür mehr
Qualität.
Dwars: Beim Thema Sponsoring denkt man sofort an die Kultur. Nicht aber an Wissenschaft. Herr Professor Dicke, könnten Sie uns den Bedarf aufzeigen, den die Universität verspürt, weil er nicht mehr mit staatlichen Mitteln gedeckt wird?
Prof. Dr. Dicke: Der Bedarf ist in der Tat vorhanden und steigt
auch. Wir müssen uns vielleicht im Unterschied zum Kultursponsoring
und Kulturmäzenatentum ganz kurz vor Augen führen, dass die
Universität zwei Primäraufgaben hat: nämlich Forschung
und Lehre. Forschung und Lehre sind primär staatlich zu finanzieren,
und doch haben wir in hohem Maße drittmittelfinanzierte Forschung.
Wenn Sie sich etwa einen Golf anschauen, da stecken so um die 700, 800
Patente drin, das heißt jede Menge Forschung! Und das funktioniert
über die Beantragung einzelner Projekte, in der Regel zwischen
zwei oder fünf Jahren, für die es bei der DFG, der Volkswagenstiftung,
der Siemensstiftung, bei einer ganzen Reihe von Stiftungen über
ein Begutachtungsverfahren Gelder gibt. Das funktioniert natürlich
nicht in der Lehre. Und hier haben wir ein strukturelles Problem in
Deutschland, das doppelter Natur ist.
Erstens ist bekannt, dass die öffentlichen Haushalte schrumpfen
und dass deshalb die Mittel, die für Forschung und Lehre zur Verfügung
stehen, nicht mehr dieselben sind wie etwa noch vor zehn Jahren. Zweitens
haben wir in Deutschland ein Problem, das uns die OECD Jahr für
Jahr vorrechnet. Wir haben uns zu sehr auf staatliche Finanzierung verlassen
und haben ein Defizit gegenüber anderen europäischen Staaten,
erst recht aber gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika,
was die private Finanzierung generell angeht. Damit meine ich nicht
nur Wirtschaftsunternehmen, sondern private Finanzierungen generell.
Hier ist der Punkt, wo wir sagen müssen, die Förderung von
Forschung und Lehre ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe, die gesellschaftlich
autonom in die Hand genommen werden muss. So sind wir etwa beim Ausbau
des orientalischen Münzkabinetts auf Mäzene angewiesen. Auch
bei den so genannten Sekundäraufgaben, die eine Hochschule hat
– also bei Kulturveranstaltungen, die ja dem Standort dienen,
wenn wir etwa im Schillerjahr ‚Die Bürgschaft‘ von
Schubert aufführen –, da müssen wir die Gelder dafür
einwerben, und wir müssen schließlich für Qualitätssteigerungen
in der Lehre private Beteiligungen gewinnen. Das ist das Umfeld, in
dem die Universität auf Sponsoring, Mäzenatentum und auch
auf Stiftungen angewiesen ist. Ein relativ neues Instrument, das in
Deutschland noch keineswegs so weit verbreitet ist und für das
die rechtlichen Rahmenbedingungen sich zwar verbessert haben, aber noch
keineswegs so sind, wie sie sein müssten, damit wir zu messbaren
Erträgen gelangen.
Dwars: Bevor wir auf die rechtlichen Rahmenbedingungen eingehen, lassen Sie uns etwas genauer über die Bedingungen für Sponsoring vor Ort reden. Wie sind Sie mit Jena zufrieden, Herr von Witzleben? Wodurch ist für Sie die kulturelle Landschaft Jena bestimmt? Was finden Sie interessant, was würden Sie sich anders wünschen?
von Witzleben: Kulturell möchte ich Jena und Weimar immer
zusammen betrachten. Das liegt ein bisschen daran, dass ich in Weimar
wohne – und das seit vielen Jahren – und hier arbeite. Ich
denke, beide Städte bilden eine Einheit. Und wenn man an andere
große Wirtschaftsstandorte denkt, so ist eine halbe Stunde Autofahrt
nichts. Sie sind in einer amerikanischen oder in einer anderen europäischen
Großstadt mal schnell zwei Stunden unterwegs, da sind die 25 Kilometer
zwischen Weimar und Jena keine Entfernung. Und dazu kommt eine traditionelle
geistige Verbindung.
Grundsätzlich muss ich aber sagen, dass es eigentlich fast schon
zuviel an kulturellen Angeboten auf diesem engen Raum gibt. Ich habe
so ein wenig Sorge, dass der Bestand etwas zersplittert wird und darunter
die Qualität des Angebotes leidet. Ein Beispiel: Ob in Erfurt eine
Oper notwendig gewesen wäre oder ob man nicht die Mittel lieber
in Weimar konzentriert hätte, um eine Oper von europäischem
Format daraus zu machen? Das hätte ich wahrscheinlich besser gefunden,
weil (Applaus) – Dankeschön – weil es im europäischen
Maßstab jedem zuzumuten gewesen wäre, von Erfurt nach Weimar
zu fahren oder von Jena nach Weimar. Davon hätten wir mehr, vor
allem eine höhere Qualität. Was ich interessant finde –
und das sollte man auch nicht unterbewerten – das ist die Kultur,
die sich in Weimar und Jena ohne öffentlich-rechtliche Unterstützung
herausbildet. Ich will das nicht Subkultur nennen, das klingt abwertend.
Da sind hochinteressante Kabaretts. Da gibt es Galerien, Aufführungen,
viel mehr als ich persönlich nutzen kann oder die meisten von uns
nutzen können. Hier sollte man sehr genau hinschauen. Ich glaube,
hier entsteht vieles, was uns in Zukunft noch begeistern wird. Nehmen
Sie zum Beispiel den Leipziger Künstler Neo Rauch. Er macht im
Moment Furore in den USA. Das ist natürlich nicht die klassische
Schule, aber seine Arbeiten sind im Grunde genommen aus einer Kultur
des Mangels entstanden und ich glaube, dass wir in diesen Randzonen
viel Kreativität begegnen können, einer großen Kraft.
Ich denke, wir sollten alle dort hinschauen, weil natürlich der
Prophet im eigenen Lande nichts gilt. Wenn ich im Ausland bin, da stelle
ich oft fest, dass die Leute begeistert sind von dem, was wir an kulturellem
Angebot haben, während wir hier jammern – und deswegen: Etwas
mehr konzentrieren und ruhig zu den Themen hinschauen, die nicht öffentlich-rechtlich
im Mittelpunkt stehen.
Dwars: Jena-Weimar war für Goethe eine Doppelstadt. Heute ist diese Einheit eine große, aber doch problematische Aufgabe, wie die reale Zusammenarbeit mit der Stiftung Weimarer Klassik zeigt. Sie könnten ein trauriges Lied davon singen, Frau Franz?
Dr. Franz: Also ganz so rosig kann ich das leider nicht darstellen,
wie ich es gerne möchte. Ich will es jetzt auch nicht kritisieren,
aber ich denke, da stecken noch sehr große Potenziale, die wir
heben müssen, um dem Namen Doppelstadt Jena-Weimar gerecht zu werden.
Also von uns aus steht das Angebot auf jeden Fall, und ich denke, es
sollte nicht nur aus der Not heraus geboren werden, dass wir zusammenarbeiten.
Es sollte auch ein freiwilliges Zusammengehen sein, und gemeinsam sollten
wir das unterstützen, was an Stärken in beiden Städten
vorhanden ist und damit auch dazu beitragen, dass wir diese Flexibilität
wahren, die wir brauchen in der Kunst, auch die Freiheit, um wieder
auf Schiller zurück zu kommen. Er hat ja gesagt ‘Kunst ist
eine Tochter der Freiheit’. Wir brauchen diese Freiheit, weil
wir uns sonst mit lauter Fixkosten die Kehle zuschnüren und überhaupt
kein Geld mehr dafür haben, um neue Projekte ins Leben zu rufen.
Das Land Thüringen gibt für Kultur 123 Millionen Euro aus.
Davon sind nur 4 Prozent für Projekte bestimmt. Alles andere sind
feste Kosten für Personal beziehungsweise Immobilien, und das macht
es natürlich ganz, ganz schwer, für eine flexible Kunst und
Kulturszene zu sorgen, wenn dafür lediglich 4 Prozent zur Verfügung
stehen, und genau diesen Fehler dürfen wir in Jena nicht wiederholen.
Mit der Gründung des Eigenbetriebes ist bei uns eine viel größere
Flexibilität entstanden, um auch auf Anforderungen der Zeit reagieren
zu können und um diese Szene unterstützen zu können.
In diese Richtung müssen wir weiterdenken.
Dwars: Anders gesagt: wir müssten Kräfte vereinen,
in größeren Projekten, die offen sind für das Andocken
anderer Unternehmen. So etwas haben wir ja hier versucht, in der Goethe-Galerie,
an dieser Ausstellung und ihrem Rahmenprogramm sind mindestens 20 Partner
beteiligt. Wie sind die Erfahrungen der Universitäten, Herr Professor
Dicke? Gibt es eine Zusammenarbeit mit der Bauhausuniversität,
die kulturelle Effekte haben könnte für beide Städte?
1859 wurde das Schillerjahr gemeinsam vorbereitet. Jetzt scheinen wir
weit davon entfernt zu sein, aber wenn wir die Doppelstadt als Auftrag
klar formulieren, dann kommen wir vielleicht auch wieder zu Lösungen.
Prof. Dicke: Ja, in der Tat, wir haben Kooperationen mit Weimar,
die sich auch im kulturellen Bereich hier in Jena niederschlagen. Das
letzte Ereignis, das mir erinnerlich ist, war ein Benefizkonzert des
Rektors der Weimarer Musikhochschule ‘Franz Liszt’ hier
in Jena. Wir haben vor drei Wochen zusammen gesessen und haben anlässlich
der jetzt bevorstehenden Wiedereröffnung der Rosensäle in
Jena, die einst ein klassischer Ort für Kammermusik gewesen sind,
darüber nachgedacht, in welcher Weise man in wissenschaftlicher
und künstlerischer Kooperation Aufführungen, die in Weimar
an der Musikhochschule zusammen eingeübt werden, auch nach Jena
bringen kann, und wie dies wissenschaftlich an beiden Orten zu betreuen
wäre. Ich glaube, dass damit deutlich ins Bewusstsein gerückt
werden kann, was Herr von Witzleben eben angesprochen hat: Es war im
19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine absolute Selbstverständlichkeit,
dass Weimar und Jena eine Einheit bilden. Übrigens würde ich
das Weimarer Land und Teile des Saale-Holzland-Kreises noch mit einbeziehen.
Wenn man sich anschaut, was in Dornburg los ist oder was an Konzerten
auf dem Land organisiert wird. Da ist wirklich ein reiches Kulturleben
in Thüringen vorhanden, das von privater Hand gestaltet wird. Aber
solche Kooperationen sind unbedingt erforderlich, um das zum Tragen
zu bringen, was wir wirklich haben, und ich denke, das müssen wir
auch mit anderen Hochschulen und Universitäten nicht nur in Thüringen
tun, sondern großräumiger denken, zum Beispiel in der Verbindung
mit Leipzig und Halle.
Dwars: Herr Noack, welche Schwerpunktsetzung würden Sie sich für Jena wünschen, welche kulturellen Veränderungen in der Zukunft?
Noack: Also, das Beispiel mit der Oper war ja klasse gewählt.
Nur das gilt dann auch für die Philharmonie in Jena. Da kommt logischerweise
kein Beifall (Lachen), hier in Jena. Die Frage kann man sich aber schon
stellen angesichts des Haushaltsdefizits, das in Jena herrscht. Angesichts
dessen, wie viele andere Projekte kaputt gehen, ist zu fragen, ob es
nicht zumutbar wäre, die halbe Stunde nach Weimar zu fahren. Es
leuchtet mir nicht ein, warum man sich in Thüringen nicht konzentriert
und sagt: in Jena ist die Universität, da müssen wir keine
zweite in Erfurt aufmachen, in Weimar gibt es die Philharmonie und die
Oper, wir brauchen keine neue in Erfurt. Dort ist die Verwaltung.
Es könnte so viel zusätzliches Geld für unter anderem
diese 200 Museen dadurch eingespart werden. Ich glaube, über kurz
oder lang werden wir über solche Dinge reden müssen, und es
wird auch kein Tabu mehr geben, so dass man sich fragt, brauchen wir
in 25 Kilometer Entfernung bei insgesamt 160.000 Einwohnern zwei solch
hochkarätige philharmonische Klangkörper? So unangenehm wie
diese Diskussion hier in Jena dann sicherlich sein würde.
Etwas anderes ist mir noch wichtig. Carl August hat damals Goethe nach
Weimar geholt, aus unterschiedlichsten Gründen, sicherlich auch
aus Eitelkeit. Er wollte sich schmücken mit dem damals schon berühmten,
aber immer noch sehr jungen Dichter. Schiller ist unter anderem deshalb
nach Thüringen gekommen, weil Goethe da war und weil Carl August
diesen Ruf verbreitet hat, einen Musenhof in Weimar gegründet zu
haben. Goethe und Schiller wiederum haben so auf die Geschichte der
beiden Städte Weimar und Jena gewirkt, dass unter anderem Zeiss
sein Unternehmen hier gründen wollte. Das hat auch hundert Jahre
später noch ausgestrahlt, und Zeiss und die Konzentration der Intelligenz
hier in Jena haben heute die Ausstrahlung, dass gerade diese beiden
Städte es sind, die nicht über gravierende Einwohnerverluste
klagen, was ja ganz außergewöhnlich ist in Ostdeutschland
und in Thüringen. Sie haben vorhin gefragt, ob es eine Rückwirkung
auf die Wirtschaft oder das Geld gibt. Natürlich gibt es das. Dieser
Ruf, eine innovative Stadt zu sein, eine Stadt, in der besonders kluge,
frische Leute sich treffen und diskutieren, das spielt natürlich
auch für die Wirtschaft und für die gesellschaftliche Entwicklung
insgesamt eine große Rolle.
Dwars: Wir haben bis jetzt eine Kunstsparte völlig vergessen, das ist das Jenaer Theaterhaus, das ja genau dieser Intention entspricht. Das eine andere Spielform bevorzugt, als etwa das Weimarer Nationaltheater. Hier wird die Frage konkret: Was fördern wir als spezifisch Jenaer Kultur? Gibt es etwas, das der Produktions- und Lebensweise dieser Stadt entspricht, dieser großen Ballung von technischer Intelligenz? Wir könnten sagen: ‘Die Großkultur ist in Weimar auf europäischem Niveau.’ Also machen wir hier so etwas wie ‚Subkultur’ oder ‚experimentelle Kultur’. Welche Chancen hat das Theaterhaus?
Dr. Franz: Das ist natürlich eine zugespitzte Frage. Ich denke, wir müssen uns schon überlegen, inwiefern wir uns von Weimar unterscheiden oder Weimar ergänzen. Es macht wirklich keinen Sinn, Weimar zu kopieren. Ich glaube, in vielen Sparten sind wir auch auf einem guten Weg dahin. Das Theaterhaus ist das beste Beispiel. Es ist eben nicht das übliche „Drei-Sparten-Theater“, sondern ein experimentelles Theater, das für Furore sorgt. Im Moment steht es oft in der Kritik, aber auch das spricht sich ja herum. Auch wenn ein Stück kritisch behandelt wird, spricht man darüber, und so muss es auch sein. Das bringt einen gewissen Geist in die Stadt, man redet über Kunst und Kultur, über die Künstler, ob sie einem gefallen oder nicht. Das ist es, was Jena auch auszeichnet, dass Kunst und Kultur sehr eng mit den Menschen verbunden sind, die hier leben. Das sollten wir auch weiterhin fördern, und in diese Richtung geht unsere Profilierung, um uns damit ein wenig von Weimar zu unterscheiden und das dortige Angebot zu ergänzen.
Dwars: Ich denke, ein besseres Schlusswort können wir nicht finden. Wir hatten uns vorgenommen, in 30 Minuten einen Spannungsbogen aufzubauen. Ich hoffe, er beschäftigt sie noch weiter. Denn wir haben nicht nur Probleme aufgehäuft, sondern auch versucht, Lösungswege zu zeigen, Perspektiven zu öffnen. Ich danke Ihnen herzlich – dem Publikum für die Aufmerksamkeit, meinen Gesprächspartnern für ihre Bereitschaft, sich auf ein so seltsames Ansinnen einzulassen: ein Nachdenken über Kultur im Konsumtempel. Wenn das Schule macht!
Aus: Palmbaum ~ Literarisches Journal aus Thüringen, Heft 1+2/2005
Matthias Biskupek
Hofrat Schiller in zwiefacher Ausfertigung
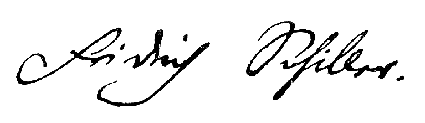 Schillerstraße
und Johann-Sebastian-Bach-Straße bildeten in Mittweida einen rechten
Winkel. Genau in diesem Winkel wohnten wir vor fünfzig Jahren:
1 Hinterhof, 1 Ofen, 2 Zimmer, 2 Kinder, 2 Eltern. Ein Fenster zum Schiller,
ein Fenster zum Bach. Später lernte ich die Talsperrenstraße,
den Boleslaw-Bierut-Platz, den Bremer Hof und die Marx-Engels-Straße,
vormals Königin-Luise-Straße, Straße der SA, Adolf-Hitler-Straße,
Schwarzburger Straße und Stalinstraße kennen. Vor zwei Jahren
zog ich wieder in eine Schillerstraße, jene in Rudolstadt: alle
Fenster zum Hain, zur Käseglocke, zum Gymnasium Fridericianum,
zur Großen Allee. Das Haus hatte mal jenen Greifenverlag beherbergt,
der Feuchtwanger und diverse Kohlrabiapostel druckte; Bücher zum
Pendeln nicht zu vergessen.
Schillerstraße
und Johann-Sebastian-Bach-Straße bildeten in Mittweida einen rechten
Winkel. Genau in diesem Winkel wohnten wir vor fünfzig Jahren:
1 Hinterhof, 1 Ofen, 2 Zimmer, 2 Kinder, 2 Eltern. Ein Fenster zum Schiller,
ein Fenster zum Bach. Später lernte ich die Talsperrenstraße,
den Boleslaw-Bierut-Platz, den Bremer Hof und die Marx-Engels-Straße,
vormals Königin-Luise-Straße, Straße der SA, Adolf-Hitler-Straße,
Schwarzburger Straße und Stalinstraße kennen. Vor zwei Jahren
zog ich wieder in eine Schillerstraße, jene in Rudolstadt: alle
Fenster zum Hain, zur Käseglocke, zum Gymnasium Fridericianum,
zur Großen Allee. Das Haus hatte mal jenen Greifenverlag beherbergt,
der Feuchtwanger und diverse Kohlrabiapostel druckte; Bücher zum
Pendeln nicht zu vergessen.
Wer in Rudolstadt strandet, muß sich mit Schiller einlassen. Als die zweihundertste Wiederkehr der Erstbegegnung Goethes und Schillers gefeiert wurde, die bekanntlich in der Rudolstädter Schillerstraße stattfand, blieb mir nichts anderes übrig, als für eine Zeitschrift, die auf den seltsamen Namen „Die Weltbühne“ hörte, einen Text unter dem Titel „Zirkel Schreibender Klassiker“ zu verfassen. Wir absolvierten gerade das Jahr 1988 und ich lebte in erwähnter Marx-Engels-Straße. Also teilte ich mit, dass man bei Renovierungsarbeiten unter der erneuerten Türschwelle des Schillerhauses Notizen von einer bislang Unbekannten gefunden habe, eine Dame aus dem Umfeld der Pauline Gotter, die sich darüber mokierte, dass Schiller während seines Urlaubs in Volkstedt als eingeschriebenes Zirkelmitglied galt, bloß, damit die Beulwitzen einen mehr melden konnte. Wir hören den Origi-nalton 1988:
„Alle taten so, als hätten sie grad Schillers Griechengedicht im ‚Teutschen Merkur‘ entdeckt. Hatten sich wunder wie. Der ‚Merkur‘ ist auch so ein Blatt, wo man nur rankommt, wenn man Leute bis Weimar hoch kennt (...) Der angesagte Kulturmit-arbeiter war der Ketelhodt. Ließ sich wahrscheinlich bloß aus Pflichtgefühl sehen. Bestimmt hätte der lieber eine Jagd mit dem Prinzen und dem Fürststellvertreter mitgemacht. Oder er wollte sich umhorchen. Man weiß ja nie, was die für Aufträge haben.
War nervend, wie alle von ihren Veröffentlichungen plapperten.
Dabei weiß man doch, wie das läuft. Die Beulwitzen kriegt
ihre dithyrambischen Anapäste unter, weil sie mit Schiller scharmutziert.
Die hatten mal was miteinander. Sogar Xenien sollen sie probiert haben,
heimlich, wenn der Beulwitz außer Haus war. Xenien! Zu zweit!
(...) Dann kam der Stargast mit einem Schwarm Anbeterinnen und Jünger.
Natürlich die Schardt, die Piepsmaus, wieder dabei. Es war bloß
der Goethe und ich dachte schon wunder wer. Angeblich hatten der und
Schiller sich noch nie gesehen. Na, ich weiß nicht. In den Journalen
werden sie doch dauernd alle beide gedruckt. Andere kommen da überhaupt
nicht ran. Ich bekomme nicht mal eine Antwort auf meine Manuskripteinsendungen.
Schiller kriegte einen roten Kopf zu seinen roten Haaren und Goethe
fing an, sich endlos über Italien zu verbreiten. Schön für
ihn, dass er schon mal da war! Angeblich hat er ja seine Aufenthaltsgenehmigung
für Rom erst gekriegt, als er schon dort war. Und dann reden sie
von einem allergnädigst-grossherzoglichen Zweijahresvisum. Man
weiß ja, was beim Weimarer Hofver-band mit Pässen für
Schindluder getrieben wird. Als ich mit der Beulwitzen mal zum Belvederer
Klassiker-Seminar geschickt wurde – war auch bloß Zufall,
sonst kommen wir Rudolstädter ja nie ran – hat sie gleich
mit Wieland, dem ollen Knacker, poussiert und bums! hatte sie ihren
Text im ‚Teutschen Merkur‘.
Goethe muß irgendwas mit einer Südlichkeitsdame in Italien
gehabt haben. Ich merk das doch. Aber grad als ich nachhaken will, fängt
der Ketelhodt eine Staats-Tirade an. Weil er nun schon mal da ist, will
er doch bemerken, dass es eine enge Ver-bundenheit von Hofstaat und
Künstlern gebe, dass nur durch die Rudolstädter Initiative
sich die beiden Dichtergeniusse – der meinte bloß Goethe
und Schiller – sich hier im Beulwitzschen Hause treffen konnten,
was uns doch alle zu Dank an die segensreiche Fürstlich-Schwarzburgische
Landesregierung ... na, das Übliche. Wahrscheinlich muß der
immer so was sagen. (...)
Nun soll der Goethe doch erst mal sehen, wie das jetzt hier bei uns wieder langgeht. Der hat ganz offensichtlich Illusionen, dass sich hier allzu viel geändert hätte. Na hallo! Die werden dem in Weimar schon den Kopf wieder aufs thüringische Lan-desmaß bringen. Von wegen Süden! Die haben dort bestimmt keinen solchen Zirkel, wie wir in Rudolstadt!“
Soweit der Ton, den wir damals ganz frech unter dem Tisch hervorflüsterten.
Wir waren arm dran, weil wir alles reichlich ausnutzen mussten, um ein
Verhältnis zu unserm Vaterlande deutlich zu machen. Also hatte
auch Schiller dran zu glauben, und unser sanftes Missbehagen zu illustrieren.
Kaum fünfzehn Jahre nach dieser Publikation ereilte mich bereits
wieder ein Auftrag. Es gibt im Ort eine Schillerschule, die einst nach
Schillers Tochter benannt wurde, nun aber doch den Meister höchstselbst
als Namensgeber auf ihr Schild geschrieben hat. Dort müssen wichtige
Bürger alljährlich eine Schillerrede halten. Offensichtlich
waren mittlerweile schon alle wichtigen Bürger aufgebraucht –
ich war dran. Da ich kaum etwas über Schiller wusste, gelang mir
eine vermutlich passable Rede – sie war ja für Schüler
gedacht, die auch kaum was wissen. Inzwischen wirft das Jubilä-umsjahr
seine Veröffentlichungen voraus – und wer in der Schillerstraße
wohnt, muss zumindest die wichtigsten lesen. Ich tue das mit Fleiß
und wenig Sachverstand – und schaue mit Wehmut auf meine unbedarfte
Rede von einst.
Sie würde mir heute nicht mehr gelingen, drum setze ich sie abschließend
hierher, um damit zu beweisen: Was wir früher nicht wussten, trug
reiche Früchte. Was wir aber heute schweißtreibend erarbeiten,
wird nur dürre Ernte uns in die Scheuer fahren. (s.a. „Gesammelte
Werke“ v. Schiller)
Der mehrfarbige Schiller
Eine Rede für die Schillerschule zu Rudolstadt am 29.11.2002
 Ihr
kennt – Sie alle kennen – die Schillerbüste. Schillers
Kopf und Hals, vom Herrn Hofbildhauer Johann Heinrich Dannecker vor
knapp zweihundert Jahren modelliert, in Ton oder Gips, in Marmor oder
vergoldetem Blech ausgeführt. So steht er in vielen Schillerstätten
herum: In Weimar natürlich, auf der Schillerhöhe in Volkstedt
und in allen Andenkenläden mit Klassik-Nippes. Im allgemeinen ist
diese Schillerbüste einfarbig, und meistens weiß. Marmorn.
Gipsern.
Ihr
kennt – Sie alle kennen – die Schillerbüste. Schillers
Kopf und Hals, vom Herrn Hofbildhauer Johann Heinrich Dannecker vor
knapp zweihundert Jahren modelliert, in Ton oder Gips, in Marmor oder
vergoldetem Blech ausgeführt. So steht er in vielen Schillerstätten
herum: In Weimar natürlich, auf der Schillerhöhe in Volkstedt
und in allen Andenkenläden mit Klassik-Nippes. Im allgemeinen ist
diese Schillerbüste einfarbig, und meistens weiß. Marmorn.
Gipsern.
Schiller war aber in Wirklichkeit mehrfarbig. So wie lebendige Menschen halt nicht einfarbig sind. Vielleicht war er nicht direkt buntgefärbt – und gepierct wohl auch nicht: Schiller als Punk wollen wir mit Rücksicht auf den Geschmack gesetzter Bürger nicht ausmalen. Ja, AUSMALEN.
Aber wir stellen uns seine Büste als wirkliches Gesicht vor: Die Nase etwas schärfer und höckeriger, mit sanfter Knolle vorn dran, nicht so edel griechisch-römisch, wie bei Herrn Dannecker; die Augen graublau, das Haar rot und nicht sonderlich ge-zähmt, also voller Wirbel, eine Menge Sommersprossen auf der blassen Haut ... Bis vor ein paar Jahren gab es in Deutschland den Spruch: Rote Haare, Sommersprossen, sind des Teufels Volksgenossen! Ist dieser Reim noch immer üblich? Vielleicht wurde Schiller als Junge ähnlich gehänselt? Außerdem hatte er einen zu langen Hals; der ganze Kerl war schlaksig, wie große Leute manchmal sind – Schiller war für damalige Verhältnisse sehr lang. Ein Freund beschreibt ihn als eine Art Storch, wie er, „ohne die Knie recht beugen zu können“, durch die Welt stakst. Wer seine Knie nicht gut beugt, wirkt leicht lächerlich – obwohl doch die Verbieger und Verbeuger die Lächerlichen sind.
Als Schiller mit knapp vierzehn Jahren auf die Karlsschule kommt, ist er noch durchschnittlich groß, Einsfünfundvierzig, wächst, bis er achtzehn ist, nur ein paar Zentimeter und schießt dann plötzlich auf die Länge von knapp Einsachtzig, zwanzig Zentime-ter höher als der Durchschnitt.
Woher ich das so genau weiß? Aus dem Buch „Vermessene Größen“, da werden auch alle Krankheiten Schillers beschrieben; ja VERMESSENE Größen; aus Büchern kann man erstaunlich viel herausfinden. Ihr könnt natürlich auch im Internet nach Schiller suchen - da bekommt Ihr siebenhundertsechzigtausend Eintragungen. Ihr erfahrt alles über einen Wein namens Schiller und über Schillerlocken; Ihr findet eine Schiller AG, die medizinische Geräte, herstellt und mit sphärischen Klängen sollt ihr zu Schiller-Weltreisen verlockt werden, die mit unserem Dichter nichts zu tun haben. – Vielleicht ist das gute alte Buch dann doch praktischer.
Wir kennen Schillers Längenwachstum, weil an der Karlsschule – einer Kadettenanstalt, wir würden sie heute als Offiziershoch-schule für Jugendliche, bezeichnen – die Zöglinge säuberlich vermessen wurden. Schließlich sollten sie mal ordentliche Soldaten werden. Dass Schiller dann kein braver Befehlsempfänger blieb – er war zeitweise Regimentsmedicus: die deutsche Sprache hat dafür auch das knackige Wort Feldscher – sondern so ziemlich das Gegenteil eines gehorsamen Militärs wurde, nämlich ein ungehorsamer Dichter, ein Schwärmer, ein aufmüpfiger Weltgeist – das hat vielleicht sogar mit jener Schule zu tun, die er absolvierte. Schulen bewirken gelegentlich das Gegenteil dessen, was sie bewirken sollen. Schillers Schule hat die Jugendlichen gewiss gefordert, aber vor allem sollte man gehorchen lernen, sollte ohne Widerspruch Befehle ausführen, sollte exakte juristische Texte verfassen, sollte einsatzbereit für den Krieg und den Sieg seines Landesvaters arbeiten.
Was aber machte Fritz Schiller? Er bewies Ungehorsam, überhörte Befehle, riss von der Schule aus, um sein Schauspiel „Die Räuber“ am Mannheimer Theater ansehen zu können; er verfasste keine exakten, sondern manchmal höchst unklare Texte, mit Aussprüchen wie: „Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern!“ Die Schwestern könnten zu Recht sagen: Warum sind nur Brüder so einzigartig? Oder wie interpretieren wir seinen Spruch: „Ein jeder wird besteuert nach Vermögen.“? – Die Wiederein-führung der Vermögenssteuer wollen die großen und christlichen Parteien heutigentags so ganz und gar nicht. Wer das fordert, ist ein Neidhammel, der das freie Spiel der wirtschaftlichen Kräfte behindert. - Ihr seht, Widersprüche beim Schiller, wohin man schaut. – Zum Krieg hatte er auch eine etwas andere Auffassung, als sein schwäbischer Fürst und der heutige Weltchef Bush: „Ein furchtbar wütend Schrecknis ist der Krieg. Er schont die Herde nicht und nicht den Hirten.“ In unserem Jahrhun-dert, da Kriege ja nicht mehr Kriege heißen, sondern „friedensschaffende Maßnahmen“, würde man Schiller sogleich des Anti-amerikanismus zeihen. Gut, er lässt auch auf die besorgte Mahnung von Frau Tell: „Die Knaben fangen zeitig an, zu schießen“, Herrn Tell antworten: „Früh übt sich, was ein Meister werden will.“ Wahrlich ein widersprüchlicher, ein überaus vielfarbiger Geselle, unser National-Dichter, den die heutigen Nationalen so gern für sich sprechen lassen.
Ich habe vorhin gesagt, Schulen bewirken manchmal das Gegenteil ihres
Erziehungszieles – könnte es also sein, wenn unsere Schule
intelligente, tolerante und weltaufgeschlossene Menschen ausbilden will
– dass wir deshalb in der Wirklichkeit so viele ungebildete, engherzige
und fremdenfeindliche Leute haben? Die Schule verkündet: Wir wollen
keine Duckmäuser und Anpasser – aber wer wirklich widerspricht,
hat es in keiner Schule dieser Welt leicht. Jugendliche wollen widersprechen
können. Ein Schiller musste dem üblichen Kadavergehorsam an
seiner Schule heftig widersprechen – mit seinem Drama „Die
Räuber“. Er widersprach so überschäumend, dass
es bei fast allen Aufführungen des Stückes damals zu Tumulten
in den Theatern kam. Wem sollen aber heute die Schüler und Jugendlichen
widersprechen? Wenn die Lehrer einmütig behaupten, der Widerspruch
sei eine Triebkraft und nur Duckmäuser ließen sich alles
gefallen? Sollen sie dem widersprechen und sagen: Ich will aber Duck-mäuser
sein? Was soll ein Schüler machen, wenn ihm Toleranz anbefohlen
wird? Soll er dem Befehl gehorchen oder soll er, um sich selbst zwischen
den vielen Befehlen zur Fremdenfreundlichkeit zu finden, zum Ausländerhasser
werden? Sind die bierdumpfen Gesellen, die manchmal auf unseren Straßen
schlichte Sprüche grölen, etwa solche Leute, die sich im Widerspruch
üben?
Nein, ich glaube, das sind eher Leute, die auf allen Kadettenanstalten
dieser Welt brav ausführten, was ihnen anbefohlen würde, ob
die Befehlspläne nun „Wüstensturm“ oder „Barbarossa“
heißen. Nur in einer relativ toleranten Gesellschaft wagen sie
sich aus ihrem geistigen Hinterhalt heraus. Ist dann also unsere tolerante
Gesellschaft schuld an allen dummen Jungs? Nein, auch das wäre
zu einfach. Allerdings ist mir eine befohlene Fremdenfreundlichkeit
– man kann auch Gastfreundschaft, Herz-lichkeit, Neugier auf den
andern, für das Wort Fremdenfreundlichkeit sagen – mir ist
eine befohlene Fremdenfreundlichkeit jedenfalls lieber, als eine gestattete,
eine von den ach so liberalen Regierungsonkels tolerierte Ausländerfeindlichkeit.
Ihr seht, man kommt auf sehr bunte Gedanken, wenn man über den ollen Schiller nachdenkt. Ich will zum Nachbarsmenschen Schiller zurückkommen, zum mehrfarbigen, der so ganz und gar nicht aus Marmor oder goldfarbenem Blech zu sein scheint. Drum ein Letztes für heute zum Nachdenken: Wenn der Schiller nun überall in Marmor herumsteht, muss man doch denken, aus seinem Munde tönte nur ein wohlgefälliges Deutsch. Voll und rund die Selbstlaute, klar und scharf die Mitlaute. Glaubt doch das nicht! Er hat schwäbisch gesprochen, dass es nur so ein Graus war. Natürlich bemühte er sich, je älter er wurde, um das sogenannte Hochdeutsch – in der Jugend aber schwäbelte er heftig. Ein rothaariger, sommersprossiger Schwabe – Ihr wisst ja selber, wenn die chicen und schnellen Reporter im Fernsehen reden, wie hochdeutsch und perfekt bei denen alles klingt. Aber manchmal befragen sie auch normale Leute – zum Beispiel jemanden aus Thüringen, gleich von nebenan: Wie seltsam, wie komisch, einerseits merkwürdig vertraut, andererseits lächerlich hört sich das an! Nun stellt Euch vor, Schiller würde von einem dieser wendig-zackigen Journalisten befragt, er müsste bei Beckmann oder gar bei Vera am Mittag Rede und Antwort stehen. Und dann hängt da so ein zaundürrer Kerl herum und schwäbelt ...
Ich wünsche Euch, Ihnen, uns, mir auch, weniger Respekt vor Marmor und vergoldetem Blech; ich will gern daran glauben, dass dahinter immer jemand steckt, der Sommersprossen hat, schwäbisch redet, herzlich gern widerspricht und neugierig auf Fremde ist.
(November 2004)
Aus: Palmbaum ~ Literarisches Journal aus Thüringen, Heft 3+4/2004